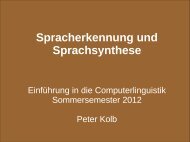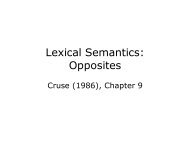Aspekte der morphologischen Analyse des Deutschen - Universität ...
Aspekte der morphologischen Analyse des Deutschen - Universität ...
Aspekte der morphologischen Analyse des Deutschen - Universität ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kapitel 3: Wortsyntax und Wortsemantik <strong>des</strong> <strong>Deutschen</strong><br />
3 Wortsyntax und Wortsemantik <strong>des</strong> <strong>Deutschen</strong><br />
Kapitel 3 faßt wesentliche theoretische Vorarbeiten aus den Bereichen Wortsyntax und<br />
Wortsemantik zusammen und beurteilt sie nach ihrer Brauchbarkeit für ein <strong>Analyse</strong>modell.<br />
Das Kapitel glie<strong>der</strong>t sich zunächst in die Gebiete Wortsyntax und Wortsemantik, wobei ersteres<br />
<strong>der</strong> traditionellen Aufteilung <strong>der</strong> Morphologie in die Bereiche Derivation und Komposition<br />
folgt. Ich möchte Flexion noch dazu nehmen, auch wenn dies inhaltlich ein an<strong>der</strong>er<br />
Prozeß ist. Die vorgeschlagene Aufglie<strong>der</strong>ung ist nicht immer glücklich, gerade in Anbetracht<br />
von vereinheitlichenden Theorien wie die von Fanselow (1985) und Höhle (1982), hilft<br />
aber dennoch, etwas Struktur in den Komplex Morphologie im weiteren Sinne hereinzubringen.<br />
3.1 Wortsyntax<br />
Der Begriff Wortsyntax impliziert, daß man Wörter nicht als unanalysierte Einheiten auffaßt,<br />
son<strong>der</strong>n ihnen auf systematische Weise eine Struktur zuweist, die sowohl für ihre syntaktischen<br />
wie auch semantischen Eigenschaften ausschlaggebend ist.<br />
Wortsyntax in dem Sinne, daß man zusammengesetzte Wörter als strukturiert auffaßt, wird<br />
von <strong>der</strong> traditionellen Grammatik nur auf durch Komposition entstandene Wörter angewandt.<br />
Es ist jedoch in Anbetracht neuerer generativer Theorien sinnvoll, diesen Begriff<br />
auch auf die Bereiche <strong>der</strong> Flexion und Derivation auszudehnen.<br />
3.1.1 Flexion<br />
Unter Flexion soll hier – in Anlehnung an Gallmann (1994) – die Bereitstellung von Wortformen<br />
mit bestimmten Merkmalen verstanden werden. Diese „Definition“ ist nicht exakt<br />
und muß noch weiter präzisiert werden. Wortformen (grammatische Wörter in <strong>der</strong> Terminologie<br />
von Di Sciullo/Williams (1987)) sind Elemente einer aus drei Komponenten aufgebauten<br />
Relation L = �* � SYN-FEATURES � SEM. Die erste Komponente ist durch die Laut-<br />
bzw. Graphemkette (Signifiant-Merkmal) <strong>der</strong> Wortform gegeben, während die zweite bzw.<br />
dritte aus den grammatischen bzw. semantischen Merkmalen <strong>der</strong> Form (Signifié-Merkmalen)<br />
besteht.<br />
Beispiel 3.1:<br />
Die Wortform lachst ist durch folgen<strong>des</strong> Tupel gegeben:<br />
.<br />
Für die Graphemkette lachen gibt es hingegen drei Elemente in dieser Relation:<br />
,<br />
und<br />
.<br />
Wortformen dürfen daher nicht mit Laut- bzw. Graphemketten verwechselt werden.<br />
Die Teilrelation L mit festgelegter dritter Komponente wird auch als Lemma, Lexem o<strong>der</strong> Wort<br />
bezeichnet. Eine Funktion lemma ordnet einer Zeichenkette Z das Lemma von Z zu. Z heißt<br />
auch Zitier- o<strong>der</strong> Nennform und benennt das Lemma. Als Nennform kann selbstverständlich<br />
je<strong>der</strong> beliebige Name gewählt werden; aus konventionellen Gründen verwendet man hierzu<br />
jedoch bestimmte, möglichst unmarkierte Wortformen aus dem Lemma, beispielsweise die<br />
Form Nominativ Singular bei Nomen o<strong>der</strong> die Infinitivform (bzw. den Stamm) bei Verben.<br />
44