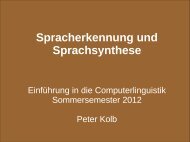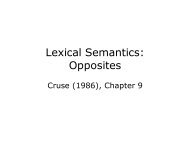Aspekte der morphologischen Analyse des Deutschen - Universität ...
Aspekte der morphologischen Analyse des Deutschen - Universität ...
Aspekte der morphologischen Analyse des Deutschen - Universität ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kapitel 3: Wortsyntax und Wortsemantik <strong>des</strong> <strong>Deutschen</strong><br />
Allerdings ist eine intransitive Verbbasis noch keine hinreichende Bedingung für die Zulässigkeit<br />
einer Nominalisierung mit -er. Intransitive Verben wie ankommen, aufwachen, fallen<br />
usw. erlauben keine er-Ableitung (vgl. auch Abschnitt 3.4.1):<br />
(64)<br />
a) * Ankommer<br />
b) * Aufwacher<br />
c) * Faller<br />
Punktuelle Verben wie erblicken 12 , erschlagen, aufwachen gestatten i.a. keine er- Nominalisierung,<br />
wobei es jedoch Ausnahmen wie finden – Fin<strong>der</strong> gibt. Die Ableitung mit -er ist auch bei<br />
<strong>der</strong> überwiegenden Zahl <strong>der</strong> ingressiven (erblühen, aufstehen, erklingen) und resultativen Verben<br />
(verblühen, verbrennen, ausklingen) nicht möglich; Ausnahmen hierbei wie Vollen<strong>der</strong> müssen<br />
wohl durch Lexikalisierung „erklärt“ werden. Fanselow (1988b) schlägt zur Erklärung<br />
dieser Ableitungsblockierung vor, daß <strong>der</strong> semantische Beitrag von -er bei <strong>der</strong> Nominalisierung<br />
u.a. <strong>der</strong> ist, daß man die durch das Verb ausgedrückte Tätigkeit gewohnheitsmäßig<br />
ausübt. Punktuelle Verben lassen eine solche Interpretation jedoch kaum zu. Besser müßten<br />
sich daher Durativa wie blühen, schlafen, wohnen nominalisieren lassen, was interessanterweise<br />
mit Ausnahme von schlafen nicht geht. Die iterativen Verben wie beispielsweise sticheln,<br />
krabbeln, grübeln bestätigen jedoch diese Erklärung.<br />
Obwohl Fanselows Ansatz zunächst äußerst vielversprechend ist, gibt es doch einige z.T.<br />
erhebliche Kritikpunkte:<br />
1. Welche Konsequenzen hat die Verlagerung <strong>der</strong> Hauptlast von den Syntaxregeln zu den<br />
logischen Typen, die den Morphemen zugeordnet sind? Zunächst einmal wird die Wortsyntax<br />
im semantischen Ansatz von Fanselow keineswegs abgeschafft; sie ist vielmehr<br />
implizit in <strong>der</strong> typenlogischen Charakterisierung <strong>der</strong> verschiedenen syntaktischen Kategorien<br />
und explizit mit den Merkmalsperkolationsbedingungen präsent. Da sich nach<br />
traditioneller Auffassung <strong>der</strong> Montague-Semantik die semantischen Typen aus den syntaktischen<br />
Kategorien durch Anwendung einer einfachen Abbildungsvorschrift ergeben,<br />
setzt Fanselows Konzeption implizit eine wortinterne Strukturierung voraus, entlang <strong>der</strong><br />
die semantischen Operationen angewendet werden. Dies bedeutet, daß die Syntax in gewisser<br />
Weise <strong>der</strong> Semantik „vorgeordnet“ ist und die Anwendung <strong>der</strong> semantischen<br />
Auswertung leitet. Nur dadurch kann u.a. verhin<strong>der</strong>t werden, daß eine Funktion auf ein<br />
Argument appliziert werden kann, das dem syntaktischen Träger <strong>der</strong> Funktion nicht<br />
benachbart ist. Meiner Meinung nach argumentiert Fanselow nicht gegen die Annahme<br />
einer syntaktischen Struktur von Wörtern, son<strong>der</strong>n nur dagegen, daß a) diese Struktur<br />
autonom ist und unabhängigen Prinzipien folgt und b) die Wortsyntax und ihre<br />
Prinzipen in <strong>der</strong> Universalgrammatik verankert sind. 13 Fanselow folgt hier Chomsky<br />
(1982), <strong>der</strong> die Wortsyntax für so trivial hält, daß sie lediglich auf <strong>der</strong> Grundlage positiver<br />
Evidenz während <strong>des</strong> Spracherwerbs erlernt werden kann.<br />
2. Was ist nun – nachdem in 1. festgestellt wurde, daß eine wortsyntaktische Ebene weiterhin<br />
angenommen werden muß – <strong>der</strong> eigentliche Gehalt von G. Fanselows Ansatz? Lei<strong>der</strong><br />
bleibt von dieser äußerst interessanten Idee weniger übrig als zuvor angenommen. Zur<br />
Explizitmachung <strong>der</strong> Wortstruktur benötigt man zunächst einen Formalismus, <strong>der</strong> in <strong>der</strong><br />
Lage ist, die Anfor<strong>der</strong>ungen, die ein syntaktischer Kopf an seine Umgebung stellt, in seiner<br />
syntaktischen Kategorie zu codieren. In Frage kämen hierzu Kategorialgrammatiken<br />
o<strong>der</strong> HPSG-ähnliche Formalismen, die in einer einem <strong>morphologischen</strong> Kopf zugeord-<br />
12 Die hier angeführten Verben entstammen dem Duden (1994:93).<br />
13 Gisbert Fanselow (p.M.) bestätigt diese Auffassung.<br />
80