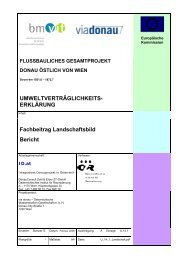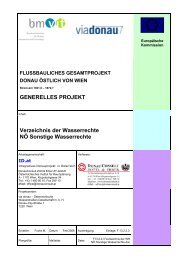Bericht Terrestrische Vegetation
Bericht Terrestrische Vegetation
Bericht Terrestrische Vegetation
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
FLUSSBAULICHES GESAMTPROJEKT DONAU ÖSTLICH VON WIEN UMWELTVERTRÄGLICHKEITSERKLÄRUNG<br />
FACHBEITRAG PFLANZEN - TERRESTRISCHE VEGETATION<br />
jekts auf das Schutzgut Trespen-Halbtrockenrasen als wahrscheinlich anzusehen. Auf den<br />
tieferen Niveaus herrscht der Rohrschwingel (Festuca arundinacea) vor, was für einen ehemals<br />
höheren Grundwasserstand auf der Wiese spricht.<br />
L008: südöstlicher Teil der nördlichen Grundbodenwiese; Im höher gelegenen nördlichen<br />
Teil der Fläche sind rund 10 % als nährstoffreicher Trespen-Halbtrockenrasen ausgebildet.<br />
Aufgrund des geringen Flurabstandes sind negative Auswirkungen des Flussbaulichen Gesamtprojekts<br />
auf das Schutzgut Trespen-Halbtrockenrasen sehr wahrscheinlich. Da der Südteil<br />
der Fläche allerdings deutlich feuchter ist und Vorkommen der gefährdeten Natternzunge<br />
(Ophioglossum vulgatum) aufweist (SCHRATT-EHRENDORFER 1993), wirkt sich eine Anhebung<br />
des GW auf die gesamte floristisch sehr reiche Wiese allerdings durchaus positiv aus.<br />
L009: Die südliche Grundbodenwiese liegt in einem Bereich von 50-60 cm Grundwasseranhebung,<br />
was einem Flurabstand zwischen 0,5 und 2 m nach Umsetzung des Flussbaulichen<br />
Gesamtprojekts entsprechen würde. Die Wahrscheinlichkeit einer Beeinträchtigung des<br />
Schutzgutes Trespen-Halbtrockenrasen, das nur rund 10 % der Gesamtfläche einnimmt ist<br />
allerdings als gering einzustufen. Es ist anzunehmen, dass sich die Trespen-<br />
Halbtrockenrasen auf diejenigen Bereiche der Wiese konzentrieren, die den höchsten Flurabstand<br />
aufweisen. Nach SCHRATT-EHRENDORFER (1993) sind die Bereiche mit Trespe teilweise<br />
eutrophiert und reich an Goldhafer (Trisetum flavescens) sowie an Glatthafer (Arrhenatherum<br />
elatius).<br />
L010: Wiese in den Heustadelböden mit einem prognostizierten Flurabstand in Teilbereichen<br />
nach Umsetzung des Flussbaulichen Gesamtprojekts von 1,5 m; Es handelt sich um sehr<br />
nährstoffreiche Trespenbestände mit hohem Anteil an Goldhafer (Trisetum flavescens). Negative<br />
Auswirkungen des Flussbaulichen Gesamtprojekts auf die Fläche sind aufgrund des<br />
hohen Flurabstandes unwahrscheinlich.<br />
L011-L013: Wiesenflächen zwischen Orth und Eckartsau mit den Flurbezeichnungen Rauhenmaiß<br />
und Roter Wert: Die Wiesen liegen in einem Bereich mit prognostizierten GW-<br />
Anhebungen von 10-20 cm, die errechneten Flurabstände betragen zwischen 1,5 und 2m.<br />
Aufgrund der geringen GW-Anhebung ist von keinen Auswirkungen des Flussbaulichen<br />
Gesamtprojekts für die Wiesen auszugehen. Bei L013 handelt es sich um die Rotewerd-<br />
Wiese, die von SCHRATT-EHRENDORFER (1993) zum Großteil als Glatthaferwiese angesprochen<br />
wird, im Nordteil vermutet sie ein Vorkommen der Glanz-Wolfsmilch (Euphorbia lucida),<br />
die allerdings von eine Anhebung des GW-Spiegels profitieren würde. Bei L011 handelt es<br />
sich um einen artenarmen Trespen-Bestand mit hohem Anteil des Landreitgrases (Calamagrostis<br />
epigeios), L012 stellt einen ebenfalls artenarmen Trespen-Bestand dar, der vermutlich<br />
auf einem ehemaligen Acker stockt.<br />
L014: Die Schreiberwiese südöstlich Eckartsau liegt in ihrem westlichsten Bereich bei einem<br />
Flurabstand von rund 1 m. Die prognostizierte GW-Anhebung beträgt in diesem Gebiet allerdings<br />
nur zwischen 10 und 20 cm, so dass von keinen Auswirkungen des Flussbaulichen<br />
Gesamtprojekts auf die Fläche ausgegangen werden kann. Die Wiese am Schreiber stellt<br />
einen großflächigen einheitlichen Furchenschwingel-Bestand (Festuca rupicola) dar. Das<br />
Vorkommen von Hohem Veilchen (Viola elatior), Filz-Segge (Carex tomentosa) und Weidenblättrigem<br />
Alant (Inula salicina) deutet auf ehemals höhere GW-Stände hin (vgl. SCHRATT-<br />
EHRENDORFER 1993), so dass mögliche Auswirkungen als positiv einzustufen wären.<br />
PROJEKTWERBER: via donau VERFASSER: AVL<br />
Februar 2006 Seite 154