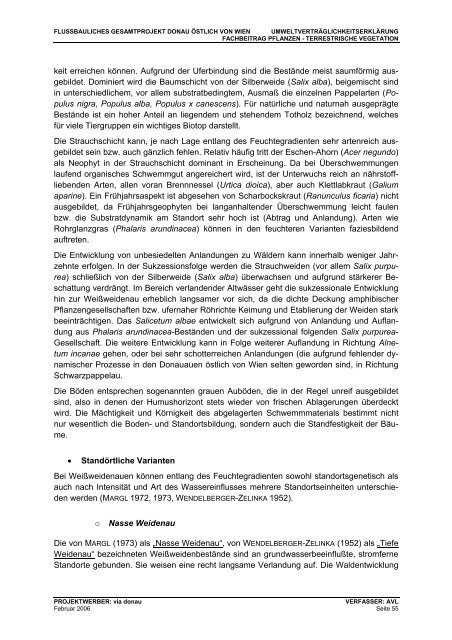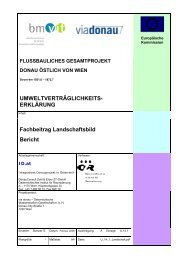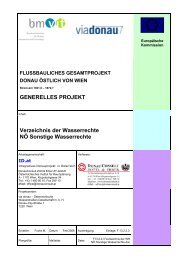Bericht Terrestrische Vegetation
Bericht Terrestrische Vegetation
Bericht Terrestrische Vegetation
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
FLUSSBAULICHES GESAMTPROJEKT DONAU ÖSTLICH VON WIEN UMWELTVERTRÄGLICHKEITSERKLÄRUNG<br />
FACHBEITRAG PFLANZEN - TERRESTRISCHE VEGETATION<br />
keit erreichen können. Aufgrund der Uferbindung sind die Bestände meist saumförmig ausgebildet.<br />
Dominiert wird die Baumschicht von der Silberweide (Salix alba), beigemischt sind<br />
in unterschiedlichem, vor allem substratbedingtem, Ausmaß die einzelnen Pappelarten (Populus<br />
nigra, Populus alba, Populus x canescens). Für natürliche und naturnah ausgeprägte<br />
Bestände ist ein hoher Anteil an liegendem und stehendem Totholz bezeichnend, welches<br />
für viele Tiergruppen ein wichtiges Biotop darstellt.<br />
Die Strauchschicht kann, je nach Lage entlang des Feuchtegradienten sehr artenreich ausgebildet<br />
sein bzw. auch gänzlich fehlen. Relativ häufig tritt der Eschen-Ahorn (Acer negundo)<br />
als Neophyt in der Strauchschicht dominant in Erscheinung. Da bei Überschwemmungen<br />
laufend organisches Schwemmgut angereichert wird, ist der Unterwuchs reich an nährstoffliebenden<br />
Arten, allen voran Brennnessel (Urtica dioica), aber auch Klettlabkraut (Galium<br />
aparine). Ein Frühjahrsaspekt ist abgesehen von Scharbockskraut (Ranunculus ficaria) nicht<br />
ausgebildet, da Frühjahrsgeophyten bei langanhaltender Überschwemmung leicht faulen<br />
bzw. die Substratdynamik am Standort sehr hoch ist (Abtrag und Anlandung). Arten wie<br />
Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea) können in den feuchteren Varianten faziesbildend<br />
auftreten.<br />
Die Entwicklung von unbesiedelten Anlandungen zu Wäldern kann innerhalb weniger Jahrzehnte<br />
erfolgen. In der Sukzessionsfolge werden die Strauchweiden (vor allem Salix purpurea)<br />
schließlich von der Silberweide (Salix alba) überwachsen und aufgrund stärkerer Beschattung<br />
verdrängt. Im Bereich verlandender Altwässer geht die sukzessionale Entwicklung<br />
hin zur Weißweidenau erheblich langsamer vor sich, da die dichte Deckung amphibischer<br />
Pflanzengesellschaften bzw. ufernaher Röhrichte Keimung und Etablierung der Weiden stark<br />
beeinträchtigen. Das Salicetum albae entwickelt sich aufgrund von Anlandung und Auflandung<br />
aus Phalaris arundinacea-Beständen und der sukzessional folgenden Salix purpurea-<br />
Gesellschaft. Die weitere Entwicklung kann in Folge weiterer Auflandung in Richtung Alnetum<br />
incanae gehen, oder bei sehr schotterreichen Anlandungen (die aufgrund fehlender dynamischer<br />
Prozesse in den Donauauen östlich von Wien selten geworden sind, in Richtung<br />
Schwarzpappelau.<br />
Die Böden entsprechen sogenannten grauen Auböden, die in der Regel unreif ausgebildet<br />
sind, also in denen der Humushorizont stets wieder von frischen Ablagerungen überdeckt<br />
wird. Die Mächtigkeit und Körnigkeit des abgelagerten Schwemmmaterials bestimmt nicht<br />
nur wesentlich die Boden- und Standortsbildung, sondern auch die Standfestigkeit der Bäume.<br />
• Standörtliche Varianten<br />
Bei Weißweidenauen können entlang des Feuchtegradienten sowohl standortsgenetisch als<br />
auch nach Intensität und Art des Wassereinflusses mehrere Standortseinheiten unterschieden<br />
werden (MARGL 1972, 1973, WENDELBERGER-ZELINKA 1952).<br />
o Nasse Weidenau<br />
Die von MARGL (1973) als „Nasse Weidenau“, von WENDELBERGER-ZELINKA (1952) als „Tiefe<br />
Weidenau“ bezeichneten Weißweidenbestände sind an grundwasserbeeinflußte, stromferne<br />
Standorte gebunden. Sie weisen eine recht langsame Verlandung auf. Die Waldentwicklung<br />
PROJEKTWERBER: via donau VERFASSER: AVL<br />
Februar 2006 Seite 55