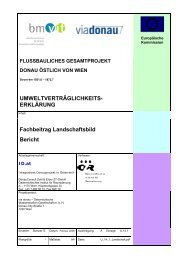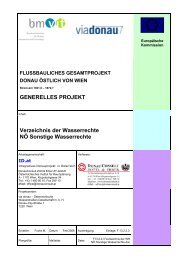Bericht Terrestrische Vegetation
Bericht Terrestrische Vegetation
Bericht Terrestrische Vegetation
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
FLUSSBAULICHES GESAMTPROJEKT DONAU ÖSTLICH VON WIEN UMWELTVERTRÄGLICHKEITSERKLÄRUNG<br />
FACHBEITRAG PFLANZEN - TERRESTRISCHE VEGETATION<br />
me (Ulmus minor) und Winterlinde (Tilia cordata) zusammen. In der Strauchschicht fallen<br />
besonders Hasel (Corylus avellana) und Kornelkirsche (Cornus mas) auf. Die Krautschicht<br />
ist artenreich ausgebildet und reich an Geophyten, wie Maiglöckchen (Convallaria majalis),<br />
Knollen-Beinwell (Symphytum tuberosum), Auen-Weißwurz (Polygonatum latifolium), Gelbes<br />
Windröschen (Anemone ranunculoides), Bärlauch (Allium ursinum) und Schneeglöckchen<br />
(Galanthus nivalis). Das Querco-Ulmetum gewinnt nach Osten zu an Bedeutung und übertrifft<br />
dort schließlich in der Flächenausdehnung das Fraxino-Populetum, das im westlichen<br />
Teil des Untersuchungsgebietes dominiert. Im östlichsten Teil der Donauauen zeigen sich<br />
deutliche Anklänge an den Pannonischen Quirleschen-Ulmen-Eichenwald (Fraxino pannonici-Ulmetum)<br />
ohne dass die Gesellschaft in reiner Form ausgewiesen werden könnte. Aktuell<br />
verzeichnen die Standorte des Querco-Ulmetum im Untersuchungsgebiet eine starke Zunahme<br />
der Silberpappel (Populus alba) und des Feldahorn (Acer campestre). Diese beiden<br />
lichtliebenden Vorholzarten profitieren vom weitgehenden Ausfall von Feld- und Flatterulme<br />
(Ulmus minor, U. laevis) infolge eines als „Ulmensterben“ bezeichneten Pilzbefalles sowie<br />
durch die Schwächung der Stieleiche (Quercus robur) durch die Riemenmistel (Loranthus<br />
europaeus). Forstlich ist die Esche (Fraxinus excelsior) stellenweise deutlich gefördert. Die<br />
Standorte werden nur sehr unregelmäßig überschwemmt. Für die Erhaltung der Gesellschaft<br />
ist eine Überschwemmung allerdings notwendig (MORAVEC etal. 1982). Bei den bestockten<br />
Böden handelt es sich um braune Auböden mit ausgeprägter Bodenreife. Durch die Schluffablagerung<br />
während der seltenen Überschwemmungsphasen sind die Böden relativ bindig.<br />
• Standörtliche Varianten<br />
Aufgrund ihrer Hydrologie lassen sich mehrere ökologische Standortsvarianten unterscheiden.<br />
o Feuchte Harte Au<br />
Die Feuchte Harte Au findet sich zumeist in Mulden und abflusslosen Beckenlagen und ist<br />
aus der Feuchten Pappelau entstanden. Sie ist durch die Beimischung von Schwarzerle (Alnus<br />
glutinosa) und Traubenkirsche (Prunus padus) gekennzeichnet. Die Standorte werden<br />
zwar selten überschwemmt, das Wasser bleibt aber aufgrund des fehlenden Abflusses länger<br />
stehen. Als Böden finden sich tiefgründige Aulehme mit gut ausgebildeter Struktur, Rostflecken<br />
steigen oft bis zum Humushorizont auf.<br />
o Frische Harte Au<br />
Die Standorte der Frischen Harten Au liegen höher als die der Feuchten Harten Au auf größeren<br />
Pultebenen, die aufgrund des bindigeren Bodens eine gute Wasserhaltekapazität besitzen,<br />
aber nur alle 2-5 Jahre überschwemmt werden. Die Bäume besitzen das gesamte<br />
Jahr über Grundwasseranschluß. Als Böden finden sich Braune Auböden mit gut ausgebildeter<br />
Auenlehmdecke. In der Frischen Harten Au liegt das ökologische Optimum der Esche.<br />
Interessant ist das häufige Auftreten der Walnuß (Juglans regia), die eine Tendenz der Verdrängung<br />
der Traubenkirsche (Prunus padus) zeigt. Unter den Sträuchern ist die Hasel (Corylus<br />
avellana) ein häufiger Begleiter.<br />
o Trockene Harte Au<br />
PROJEKTWERBER: via donau VERFASSER: AVL<br />
Februar 2006 Seite 60