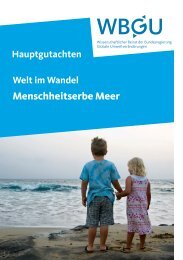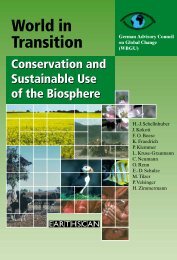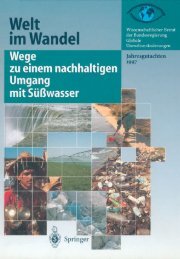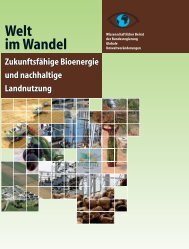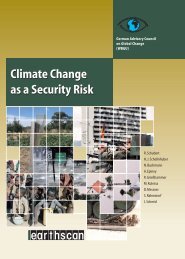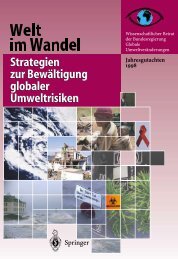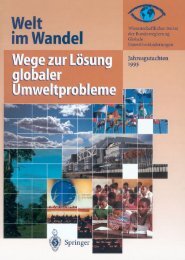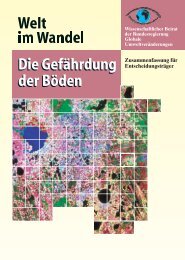Download als PDF (2,7 MB) - WBGU
Download als PDF (2,7 MB) - WBGU
Download als PDF (2,7 MB) - WBGU
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
für den internationalen Klimaschutz angebracht. Der <strong>WBGU</strong> betrachtet die G8+5-Staaten <strong>als</strong><br />
potenziellen „Motor der internationalen Klimapolitik“ und erwartet, dass die<br />
Klimaverhandlungen durch diese Ländergruppe „eine neue Dynamik erhalten“ (<strong>WBGU</strong> 2007:<br />
3). Konkret schlägt der <strong>WBGU</strong> vor, dass diese Staatengruppe einen „Innovationspakt zur<br />
Dekarbonisierung“ vereinbaren sollte (ebd.).<br />
In den letzten Jahren haben die Staats- und Regierungschefs und die jeweils zuständigen<br />
Minister in den G-Foren damit begonnen, sich der Thematik des Klimaschutzes zuzuwenden<br />
(siehe unter 2.1). Dies zeigt, dass der politische Wille vorhanden ist, diese Gremien zu nutzen,<br />
um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Dass die politischen Entscheidungsträger diese<br />
Bereitschaft zeigen, ist eine wichtige Voraussetzung dafür, den Klimaschutz dauerhaft zu<br />
integrieren und dadurch letztlich international voranzutreiben. Wie können die G-Foren so<br />
gestaltet werden, dass diese Ziele tatsächlich erreicht werden? Die bisherigen Bemühungen<br />
reichen hierfür nicht aus. Wohl aber bieten sich Möglichkeiten zu ihrer mittel- bis<br />
langfristigen Umgestaltung, die in diesem Beitrag vorgestellt werden.<br />
Das Papier ist wie folgt gegliedert: In einem ersten Schritt wird ein Überblick über die<br />
Integration von Umweltschutzaspekten in die Weltbank und die Welthandelsorganisation<br />
(WTO) gegeben. Es wird beschrieben, wie die institutionelle Berücksichtigung von<br />
Umweltaspekten in der Weltbank sowie der Welthandelsorganisation im Zeitverlauf erfolgte.<br />
In beiden Fällen handelt es sich um internationale Organisationen, die sich – ebenso wie die<br />
G-Foren – zum Zeitpunkt ihrer Gründung nicht mit dem Umweltschutz befassten und<br />
vorrangig entwicklungspolitische bzw. ökonomische Ziele verfolgen. Hierbei wird beleuchtet,<br />
welche wesentlichen internen strukturellen Veränderungen jeweils im Hinblick auf den<br />
Umweltschutz vorgenommen wurden. Anhand dieser Veränderungen lässt sich erkennen, wie<br />
die beiden internationalen Organisationen das Problem des Umweltschutzes institutionell<br />
verarbeiteten und somit eine strukturelle Grundlage für ihr umweltpolitisches Potenzial<br />
aufbauten. 4<br />
Sodann wird aufgezeigt, welche internen und externen Faktoren die Umweltintegration in<br />
den jeweiligen Organisationen maßgeblich beeinflussten. Grundlage der beiden Fallstudien ist<br />
jeweils der Stand der wissenschaftlichen Analyse der Umweltintegration in der Weltbank und<br />
der WTO sowie eine ergänzend vorgenommene Dokumentenanalyse. Auf der Basis der<br />
3 Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Russland, USA sowie die Europäische<br />
Kommission plus die fünf großen Schwellenländer Brasilien, China, Indien, Mexiko und Südafrika.<br />
4 Indem der Blick in der beschriebenen Weise auf die Umweltintegration gerichtet wird, knüpft dieser Beitrag an<br />
wissenschaftliche Analysen des environmental mainstreamings an, die bislang zu Organisationen auf nationaler<br />
Ebene (Jänicke 2007; Jacob/Volkery 2007), regionaler und supranationaler Ebene (Jordan/Lenschow 2008;<br />
Kopp-Malek et al. 2009) sowie, in jüngster Zeit, auf internationaler Ebene (Biermann et al. 2009; Nilsson et al.<br />
2009; Oberthür 2009) durchgeführt wurden.<br />
3