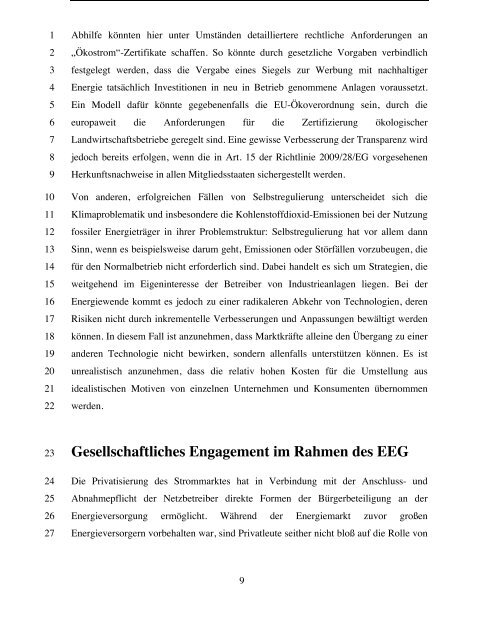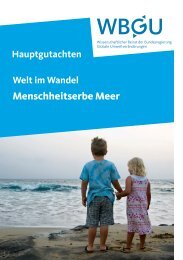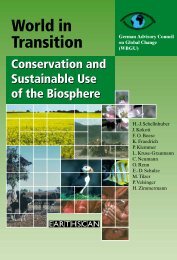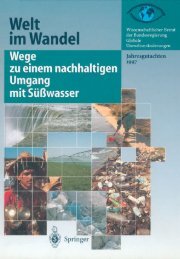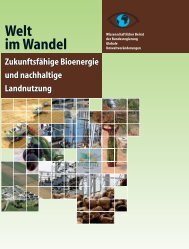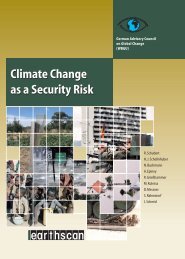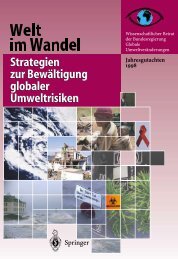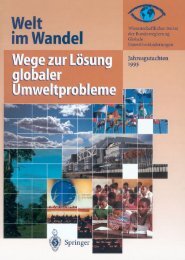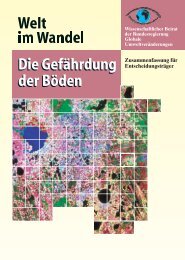Download als PDF (2,7 MB) - WBGU
Download als PDF (2,7 MB) - WBGU
Download als PDF (2,7 MB) - WBGU
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
22<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
Abhilfe könnten hier unter Umständen detailliertere rechtliche Anforderungen an<br />
„Ökostrom“-Zertifikate schaffen. So könnte durch gesetzliche Vorgaben verbindlich<br />
festgelegt werden, dass die Vergabe eines Siegels zur Werbung mit nachhaltiger<br />
Energie tatsächlich Investitionen in neu in Betrieb genommene Anlagen voraussetzt.<br />
Ein Modell dafür könnte gegebenenfalls die EU-Ökoverordnung sein, durch die<br />
europaweit die Anforderungen für die Zertifizierung ökologischer<br />
Landwirtschaftsbetriebe geregelt sind. Eine gewisse Verbesserung der Transparenz wird<br />
jedoch bereits erfolgen, wenn die in Art. 15 der Richtlinie 2009/28/EG vorgesehenen<br />
Herkunftsnachweise in allen Mitgliedsstaaten sichergestellt werden.<br />
Von anderen, erfolgreichen Fällen von Selbstregulierung unterscheidet sich die<br />
Klimaproblematik und insbesondere die Kohlenstoffdioxid-Emissionen bei der Nutzung<br />
fossiler Energieträger in ihrer Problemstruktur: Selbstregulierung hat vor allem dann<br />
Sinn, wenn es beispielsweise darum geht, Emissionen oder Störfällen vorzubeugen, die<br />
für den Normalbetrieb nicht erforderlich sind. Dabei handelt es sich um Strategien, die<br />
weitgehend im Eigeninteresse der Betreiber von Industrieanlagen liegen. Bei der<br />
Energiewende kommt es jedoch zu einer radikaleren Abkehr von Technologien, deren<br />
Risiken nicht durch inkrementelle Verbesserungen und Anpassungen bewältigt werden<br />
können. In diesem Fall ist anzunehmen, dass Marktkräfte alleine den Übergang zu einer<br />
anderen Technologie nicht bewirken, sondern allenfalls unterstützen können. Es ist<br />
unrealistisch anzunehmen, dass die relativ hohen Kosten für die Umstellung aus<br />
idealistischen Motiven von einzelnen Unternehmen und Konsumenten übernommen<br />
werden.<br />
Gesellschaftliches Engagement im Rahmen des EEG<br />
Die Privatisierung des Strommarktes hat in Verbindung mit der Anschluss- und<br />
Abnahmepflicht der Netzbetreiber direkte Formen der Bürgerbeteiligung an der<br />
Energieversorgung ermöglicht. Während der Energiemarkt zuvor großen<br />
Energieversorgern vorbehalten war, sind Privatleute seither nicht bloß auf die Rolle von<br />
9