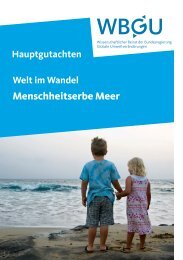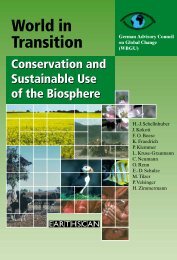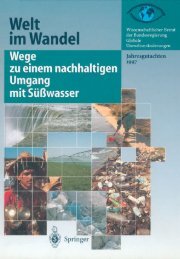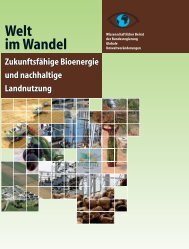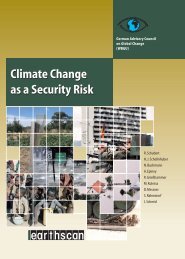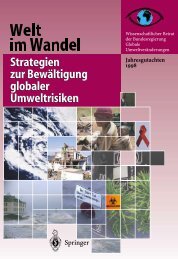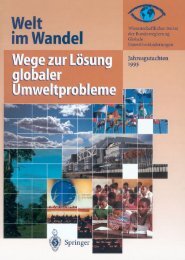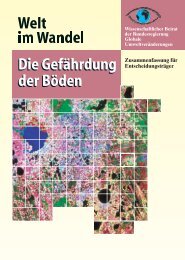Download als PDF (2,7 MB) - WBGU
Download als PDF (2,7 MB) - WBGU
Download als PDF (2,7 MB) - WBGU
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
22<br />
23<br />
24<br />
25<br />
Verhältnis zwischen „Ökostrom“-Handel und<br />
Einspeisetarifmodell<br />
Sowohl Ökostromhandel <strong>als</strong> auch die Nutzung der Möglichkeiten des Erneuerbare-<br />
Energien-Gesetzes bieten Entscheidungs- und Einflussmöglichkeiten für Bürger, die zu<br />
einer gesellschaftlichen Transformation beitragen können. Während die Beteiligung an<br />
Betreibergemeinschaften eine relativ hohe Einsatzbereitschaft und finanzielles<br />
Engagement voraussetzt, ist der Wechsel zu Ökostromangeboten relativ einfach und oft<br />
kostengünstig. Auf der anderen Seite kann Strom, der gemäß dem EEG abgenommen<br />
und vergütet werden musste, von den Energieversorgungsunternehmen nicht <strong>als</strong><br />
zertifizierter Ökostrom verkauft werden. Insofern sind beide Instrumente, Zertifizierung<br />
und Einspeisevergütung, <strong>als</strong> Ergänzung anzusehen.<br />
Auf der anderen Seite wird der Handel mit Herkunftszertifikaten für nachhaltig<br />
erzeugten Strom auch <strong>als</strong> Alternative zum Einspeisetarifmodell gehandelt. So wird von<br />
manchen Umweltökonomen gefordert, ganz auf die Förderung durch eine<br />
Einspeisevergütung nach dem EEG zu verzichten. Stattdessen soll der Ökostromhandel<br />
dadurch gefördert werden, dass bestimmte Strommarktteilnehmer staatlicherseits zur<br />
Abnahme von Strom aus nachhaltigen Energiequellen verpflichtet werden. Dieses sog.<br />
Quotenmodell ist normalerweise an ein System handelbarer Zertifikate gebunden, da die<br />
Quote in der Regel nicht über eine rein bilanzielles oder physikalische Einspeisung<br />
gedeckt werden kann. xxvi Während die meisten europäischen Staaten dem<br />
Einspeisetarifmodell folgen, xxvii hat etwa Großbritannien das Quotenmodell in Form<br />
einer „renewables obligation“ mit dem Utilities Act 2000 eingeführt. In der FDP wurde<br />
diskutiert, die Einspeisevergütung des EEG durch dieses Modell zu ersetzen, was<br />
jedoch nicht in das Wahlprogramm 2009 aufgenommen wurde. Oft wird angenommen,<br />
dass das Quotenmodell über den Markt zu einem effizienterem Einsatz der Mittel für<br />
25<br />
xxvi W. Lehnert / J. Vollprecht: „Neue Impulse von Europa: Die Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU“,<br />
Zeitschrift für Umweltrecht 2009, S. 307, 311; vgl. auch M. Kloepfer: Umweltrecht, München 3. Aufl.<br />
2004, § 16 Rn. 133.<br />
xxvii W. Lehnert / J. Vollprecht: „Neue Impulse von Europa: Die Erneuerbare-Energien-Richtlinie der<br />
EU“, Zeitschrift für Umweltrecht 2009, S. 307, 311.<br />
12