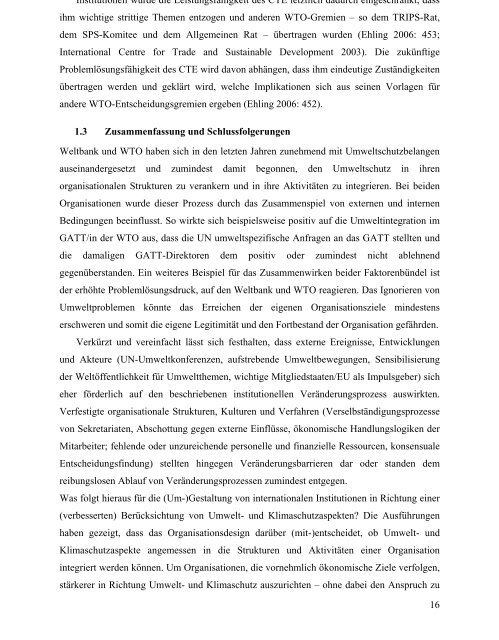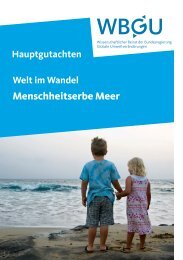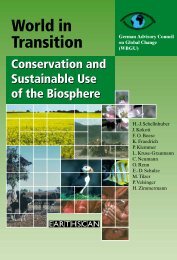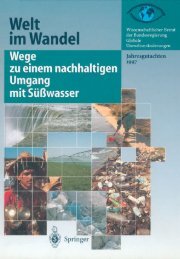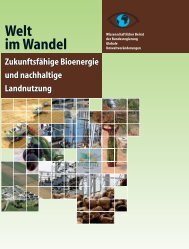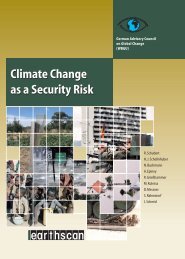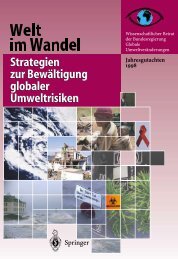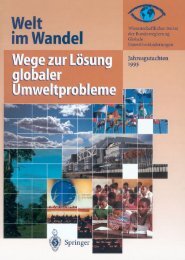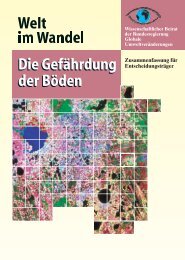Download als PDF (2,7 MB) - WBGU
Download als PDF (2,7 MB) - WBGU
Download als PDF (2,7 MB) - WBGU
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Institutionell wurde die Leistungsfähigkeit des CTE letztlich dadurch eingeschränkt, dass<br />
ihm wichtige strittige Themen entzogen und anderen WTO-Gremien – so dem TRIPS-Rat,<br />
dem SPS-Komitee und dem Allgemeinen Rat – übertragen wurden (Ehling 2006: 453;<br />
International Centre for Trade and Sustainable Development 2003). Die zukünftige<br />
Problemlösungsfähigkeit des CTE wird davon abhängen, dass ihm eindeutige Zuständigkeiten<br />
übertragen werden und geklärt wird, welche Implikationen sich aus seinen Vorlagen für<br />
andere WTO-Entscheidungsgremien ergeben (Ehling 2006: 452).<br />
1.3 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen<br />
Weltbank und WTO haben sich in den letzten Jahren zunehmend mit Umweltschutzbelangen<br />
auseinandergesetzt und zumindest damit begonnen, den Umweltschutz in ihren<br />
organisationalen Strukturen zu verankern und in ihre Aktivitäten zu integrieren. Bei beiden<br />
Organisationen wurde dieser Prozess durch das Zusammenspiel von externen und internen<br />
Bedingungen beeinflusst. So wirkte sich beispielsweise positiv auf die Umweltintegration im<br />
GATT/in der WTO aus, dass die UN umweltspezifische Anfragen an das GATT stellten und<br />
die damaligen GATT-Direktoren dem positiv oder zumindest nicht ablehnend<br />
gegenüberstanden. Ein weiteres Beispiel für das Zusammenwirken beider Faktorenbündel ist<br />
der erhöhte Problemlösungsdruck, auf den Weltbank und WTO reagieren. Das Ignorieren von<br />
Umweltproblemen könnte das Erreichen der eigenen Organisationsziele mindestens<br />
erschweren und somit die eigene Legitimität und den Fortbestand der Organisation gefährden.<br />
Verkürzt und vereinfacht lässt sich festhalten, dass externe Ereignisse, Entwicklungen<br />
und Akteure (UN-Umweltkonferenzen, aufstrebende Umweltbewegungen, Sensibilisierung<br />
der Weltöffentlichkeit für Umweltthemen, wichtige Mitgliedstaaten/EU <strong>als</strong> Impulsgeber) sich<br />
eher förderlich auf den beschriebenen institutionellen Veränderungsprozess auswirkten.<br />
Verfestigte organisationale Strukturen, Kulturen und Verfahren (Verselbständigungsprozesse<br />
von Sekretariaten, Abschottung gegen externe Einflüsse, ökonomische Handlungslogiken der<br />
Mitarbeiter; fehlende oder unzureichende personelle und finanzielle Ressourcen, konsensuale<br />
Entscheidungsfindung) stellten hingegen Veränderungsbarrieren dar oder standen dem<br />
reibungslosen Ablauf von Veränderungsprozessen zumindest entgegen.<br />
Was folgt hieraus für die (Um-)Gestaltung von internationalen Institutionen in Richtung einer<br />
(verbesserten) Berücksichtung von Umwelt- und Klimaschutzaspekten? Die Ausführungen<br />
haben gezeigt, dass das Organisationsdesign darüber (mit-)entscheidet, ob Umwelt- und<br />
Klimaschutzaspekte angemessen in die Strukturen und Aktivitäten einer Organisation<br />
integriert werden können. Um Organisationen, die vornehmlich ökonomische Ziele verfolgen,<br />
stärkerer in Richtung Umwelt- und Klimaschutz auszurichten – ohne dabei den Anspruch zu<br />
16