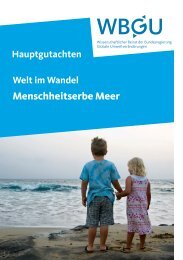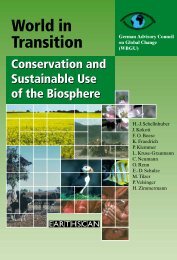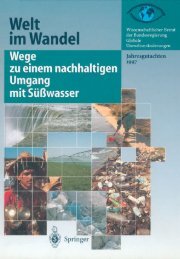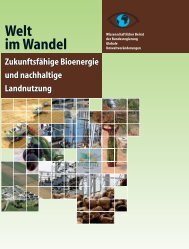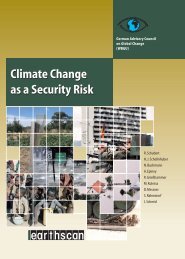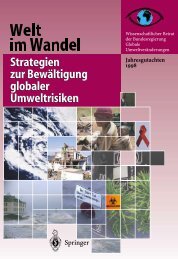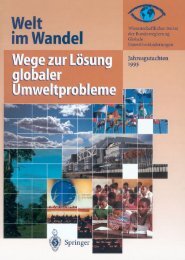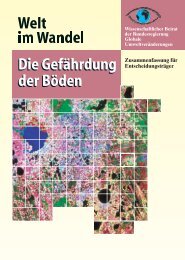Download als PDF (2,7 MB) - WBGU
Download als PDF (2,7 MB) - WBGU
Download als PDF (2,7 MB) - WBGU
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
22<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
Marktmodell, das sich an einem Leitbild der Konsumentendemokratie orientiert. Durch<br />
ethischen Konsum sollen dabei Sozial- und Umweltstandards befördert werden.<br />
Unterstützt werden können diese Standards durch staatliche oder europäische<br />
nachfrageorientierte Förderinstrumente. v Daneben gibt es auch ein eher<br />
zivilgesellschaftlich oder genossenschaftlich ausgerichtetes Modell gesellschaftlicher<br />
Selbsttransformation. Während ersteres Modell auf die individuellen Entscheidungen<br />
einzelner Konsumenten und Unternehmen setzt, geht es beim zivilgesellschaftlichen<br />
Modell um öffentliche Mitwirkung und um gesellschaftliche Lernprozesse, um soziale<br />
Normen und neue Formen der Kooperation. Besonders ausgeprägte Möglichkeiten der<br />
zivilgesellschaftlichen Beteiligung an der Klimawende haben sich im Bereich der<br />
dezentralen Energieversorgung ergeben. Die Bürgerbeteiligung an der<br />
Energieversorgung kann insbesondere durch angebotsorientierte Förderinstrumente, wie<br />
Einspeisetarife, ermöglicht werden. vi<br />
Beide Formen gesellschaftlicher Einflussnahme haben im Bereich des Klimaschutzes<br />
vor allem durch die Privatisierung der Energieversorgung und Liberalisierung der<br />
Strommärkte an Bedeutung gewonnen. Dadurch wurden die Wahl- und<br />
Einflussmöglichkeiten gesellschaftlicher Akteure hinsichtlich der Versorgung und des<br />
Konsums von Energie gestärkt. Neben einer möglichst nachhaltigen und effizienten<br />
Energieversorgung ergeben sich vielfältige Möglichkeiten den Energieverbrauch<br />
einzusparen. So kann auf Energieeffizienz von Konsumgütern geachtet und auf<br />
besonders energieintensive Aktivitäten wie Inlandsflüge verzichtet werden. Letztlich<br />
haben fast alle Aktivitäten oder Entscheidungen von privaten Haushalten oder<br />
Unternehmen irgendeine Relevanz für den Klimaschutz.<br />
Solange die getroffenen Entscheidungen jedoch lediglich „ad hoc“ getroffen werden<br />
und ohne öffentliche Resonanz stattfinden, ist ihre Relevanz für einen gesellschaftlichen<br />
Wandelungsprozess gering. Mittlerweile gibt es jedoch zahlreiche Beispiele dafür, dass<br />
Klimaschutz und insbesondere CO2-Management sich in der<br />
27<br />
v M. Bechberger et al: „Erfolgsbedingungen von Instrumenten zur Förderung Erneuerbarer Energien im<br />
Strommarkt“, FFU-Report 01-2003, S. 10 ff.<br />
3