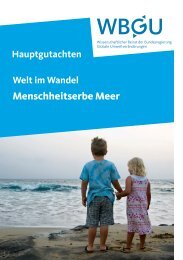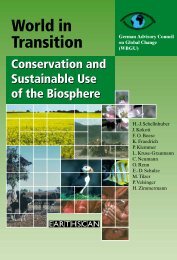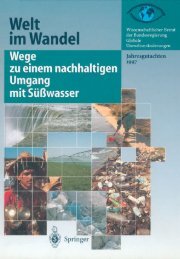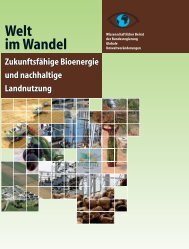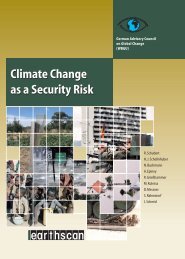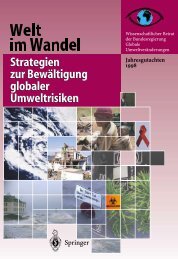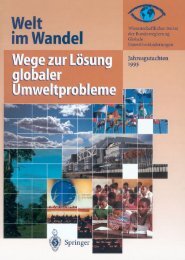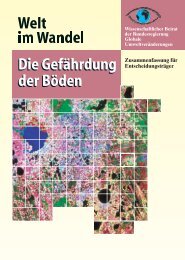Download als PDF (2,7 MB) - WBGU
Download als PDF (2,7 MB) - WBGU
Download als PDF (2,7 MB) - WBGU
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
untersuchen, inwiefern sich umweltpolitische Maßnahmen auf den internationalen Handel<br />
auswirken könnten. Die GATT-Unterzeichner entschlossen sich, dem nachzukommen und<br />
riefen die EMIT-Gruppe ins Leben. 19 Die Unterzeichnerstaaten zeigten jedoch erst 1991 ein<br />
Interesse an einem Zusammenkommen der EMIT-Gruppe. Die EFTA-Staaten begründeten ihr<br />
entsprechendes Anliegen damit, dass „die Entwicklungen im internationalen Umweltschutz<br />
sowie der verstärkte Rückgriff auf umweltpolitisch motivierte Handelsrestriktionen eine<br />
Auseinandersetzung mit dieser Entwicklung im Rahmen des GATT notwendig machten“<br />
(Pfahl 2000: 156). In der Abschlusserklärung der Uruguay-Runde fand der Umweltschutz<br />
allerdings keine Erwähnung (Senti 2007: 34).<br />
Im Falle der WTO waren externe Anforderungen, die an das Welthandelssystem gestellt<br />
wurden, gleichermaßen wichtige Auslöser für die Befassung mit dem Umweltschutz und<br />
dessen institutioneller Verankerung. So hatte die Konferenz für Umwelt und Entwicklung, die<br />
1992 in Rio de Janeiro stattfand, das GATT aufgefordert, die Welthandelsordnung verstärkt<br />
an Umweltschutzerfordernissen auszurichten. Dies hatte zur Folge, dass der Umweltbezug in<br />
die WTO-Präambel aufgenommen wurde (Senti 2007: 34). Bereits in einem unter dem<br />
damaligen GATT-Generaldirektor Arthur Dunkel ausgearbeiteten Bericht über eine<br />
Neuausrichtung des GATT (1991) hieß es, dass die internationalen Handels- und<br />
Wirtschaftsbeziehungen sich nicht auf die „volle Erschließung der Hilfsquellen“, sondern auf<br />
die „optimale Nutzung der natürlichen Ressourcen“ konzentrieren sollten (zitiert nach Senti<br />
2007: 34). Senti interpretiert die Anforderungen der Rio-Konferenz <strong>als</strong> eine<br />
„Rückendeckung“ für den GATT-Generaldirektor und verweist in diesem Zusammenhang<br />
darauf, dass die Weltöffentlichkeit nach folgenschweren Umweltkatastrophen – so der<br />
Chemieunfall von Seveso (1976) und die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl (1986) – für<br />
Umweltschutzthemen sensibilisiert war (ebd.).<br />
Schließlich lässt sich die Einrichtung des CTE und einer Abteilung für Handel und<br />
Umwelt im WTO-Sekretariat einerseits mit dem zunehmenden Erfolg von Umwelt-NGOs in<br />
den Industrieländern erklären (Ehling 2006: 441f.). Die Politiker sahen sich dazu veranlasst<br />
auf den Vorwurf zu reagieren, sich der Umweltthematik nicht angemessenen zugewandt zu<br />
haben. Hinzu kam das von wirtschaftlichen Interessengruppen vorgebrachte ökonomische<br />
Interesse an der Befassung mit der Thematik (ebd.). Dass der CTE den von Umweltaktivisten<br />
erhofften Durchbruch bei der Neugestaltung der Welthandelsordnung nicht erbrachte, lässt<br />
sich, neben internen strukturellen Zwängen, auf den unzureichenden politischen Willen<br />
zurückführen. So ist das Thema „Handel und Umwelt“ auf der politischen Agenda der WTO-<br />
19 Ebd.<br />
14