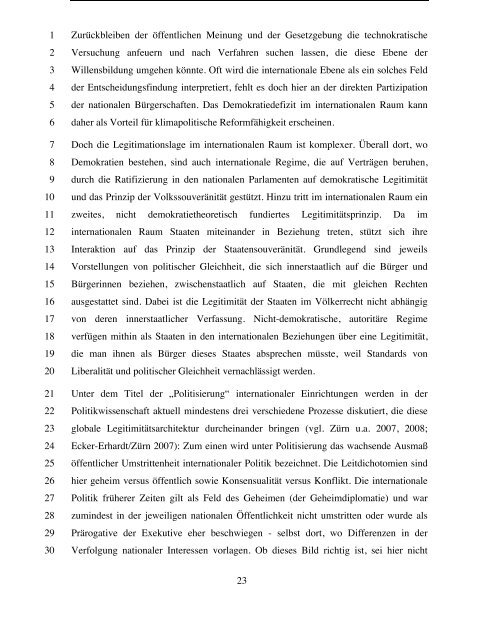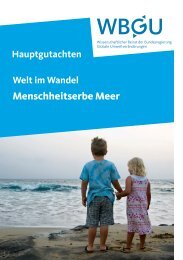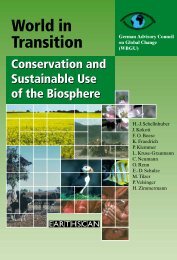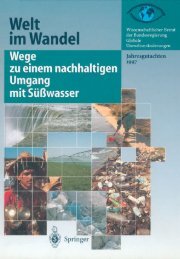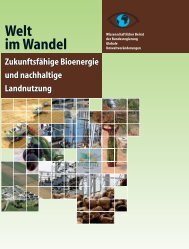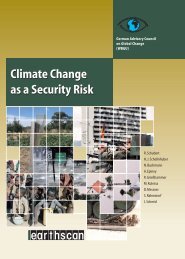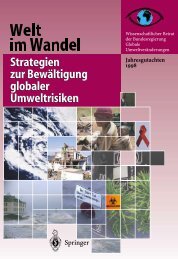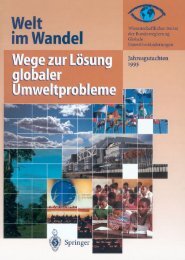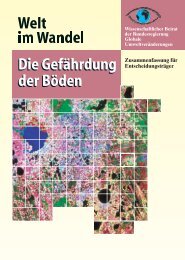Download als PDF (2,7 MB) - WBGU
Download als PDF (2,7 MB) - WBGU
Download als PDF (2,7 MB) - WBGU
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
22<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
30<br />
Zurückbleiben der öffentlichen Meinung und der Gesetzgebung die technokratische<br />
Versuchung anfeuern und nach Verfahren suchen lassen, die diese Ebene der<br />
Willensbildung umgehen könnte. Oft wird die internationale Ebene <strong>als</strong> ein solches Feld<br />
der Entscheidungsfindung interpretiert, fehlt es doch hier an der direkten Partizipation<br />
der nationalen Bürgerschaften. Das Demokratiedefizit im internationalen Raum kann<br />
daher <strong>als</strong> Vorteil für klimapolitische Reformfähigkeit erscheinen.<br />
Doch die Legitimationslage im internationalen Raum ist komplexer. Überall dort, wo<br />
Demokratien bestehen, sind auch internationale Regime, die auf Verträgen beruhen,<br />
durch die Ratifizierung in den nationalen Parlamenten auf demokratische Legitimität<br />
und das Prinzip der Volkssouveränität gestützt. Hinzu tritt im internationalen Raum ein<br />
zweites, nicht demokratietheoretisch fundiertes Legitimitätsprinzip. Da im<br />
internationalen Raum Staaten miteinander in Beziehung treten, stützt sich ihre<br />
Interaktion auf das Prinzip der Staatensouveränität. Grundlegend sind jeweils<br />
Vorstellungen von politischer Gleichheit, die sich innerstaatlich auf die Bürger und<br />
Bürgerinnen beziehen, zwischenstaatlich auf Staaten, die mit gleichen Rechten<br />
ausgestattet sind. Dabei ist die Legitimität der Staaten im Völkerrecht nicht abhängig<br />
von deren innerstaatlicher Verfassung. Nicht-demokratische, autoritäre Regime<br />
verfügen mithin <strong>als</strong> Staaten in den internationalen Beziehungen über eine Legitimität,<br />
die man ihnen <strong>als</strong> Bürger dieses Staates absprechen müsste, weil Standards von<br />
Liberalität und politischer Gleichheit vernachlässigt werden.<br />
Unter dem Titel der „Politisierung“ internationaler Einrichtungen werden in der<br />
Politikwissenschaft aktuell mindestens drei verschiedene Prozesse diskutiert, die diese<br />
globale Legitimitätsarchitektur durcheinander bringen (vgl. Zürn u.a. 2007, 2008;<br />
Ecker-Erhardt/Zürn 2007): Zum einen wird unter Politisierung das wachsende Ausmaß<br />
öffentlicher Umstrittenheit internationaler Politik bezeichnet. Die Leitdichotomien sind<br />
hier geheim versus öffentlich sowie Konsensualität versus Konflikt. Die internationale<br />
Politik früherer Zeiten gilt <strong>als</strong> Feld des Geheimen (der Geheimdiplomatie) und war<br />
zumindest in der jeweiligen nationalen Öffentlichkeit nicht umstritten oder wurde <strong>als</strong><br />
Prärogative der Exekutive eher beschwiegen - selbst dort, wo Differenzen in der<br />
Verfolgung nationaler Interessen vorlagen. Ob dieses Bild richtig ist, sei hier nicht<br />
23