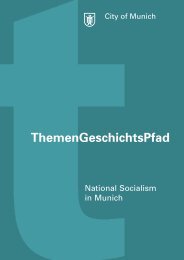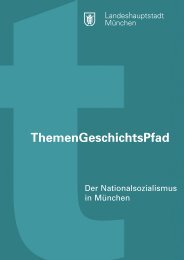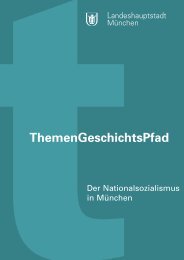Mahnmale, Gedenkstätten, Erinnerungsorte für die Opfer des ...
Mahnmale, Gedenkstätten, Erinnerungsorte für die Opfer des ...
Mahnmale, Gedenkstätten, Erinnerungsorte für die Opfer des ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ab Herbst 1941 knüpfte Hans Scholl engen Kontakt zu dem katholischen Publizisten<br />
und Herausgeber der Zeitschrift „Hochland“ Carl Muth 189 , den er durch Otl<br />
Aicher kennen lernte, und <strong>des</strong>sen Bibliothek er betreute. Im seinem Hause machte<br />
er auch Bekanntschaft mit dem Kulturphilosophen Theodor Haecker, der von den<br />
Nationalsozialisten Schreibverbot erhalten hatte und in <strong>die</strong>ser Zeit heimlich <strong>die</strong><br />
Tag- und Nachtbücher schrieb. Stundenlang konnte Hans sich mit der riesigen<br />
Bibliothek von Carl Muth beschäftigen, wo Dichter, Gelehrte und Philosophen<br />
verkehrten. Hundert Türen und Fenster in <strong>die</strong> Welt <strong>des</strong> Geistes taten sich ihm im<br />
Gespräch mit ihnen auf. 190 Auch seine Freunde lernten Theodor Haecker bei den<br />
Diskussions- und Leseabenden kennen. Von Sophie Scholl ist darüber folgen<strong>des</strong><br />
erhalten: „Seine Worte fallen langsam wie Tropfen, <strong>die</strong> man schon vorher sich<br />
sammeln sieht und <strong>die</strong> in <strong>die</strong>se Erwartung hinein mit ganz besonderem Gewicht<br />
fallen. Er hat ein stilles Gesicht, einen Blick, als sähe er nach innen.“ 191 Haecker<br />
gilt wie Muth zu den Mentoren der „Weißen Rose“. Im Frühsommer 1942 verfasste<br />
Hans Scholl zusammen mit Alexander Schmorell <strong>die</strong> ersten Flugblätter. Von<br />
Ende Juli bis 6. November 1942 wurde Hans Scholl zusammen mit Willi Graf und<br />
Alexander Schmorell zur „Feldfamulatur“ an <strong>die</strong> Ostfront abkomman<strong>die</strong>rt. Als sie<br />
am 26. Juli 1942 in das Warschauer Ghetto kamen, hatten <strong>die</strong> Deportationen in <strong>die</strong><br />
Vernichtungslager bereits begonnen. Das Tagebuch von Willi Graf gibt darüber<br />
Auskunft: „Am Spätnachmittag gehen wir in <strong>die</strong> Stadt. Das Elend sieht uns an.“ 192<br />
Sie sahen auch, wie <strong>die</strong> deutsche Wehrmacht mit den Juden und mit russischen<br />
Kriegsgefangenen umging.<br />
Zuhause verurteilte man den Vater, Robert Scholl, zu einer vierjährigen Gefängnisstrafe,<br />
nachdem er von einem Angestellten denunziert worden war. Die Mutter bat<br />
<strong>die</strong> beiden Söhne, <strong>die</strong> in Russland an der Front waren (Werner Scholl ist später in<br />
Russland gefallen), ein Gnadengesuch einzureichen. Dazu vermerkte Hans Scholl<br />
in sein Tagebuch: „Ich werde <strong>die</strong>s unter keinen Umständen tun. Ich werde nicht um<br />
Gnade bitten. Ich kenne den falschen, aber auch den wahren Stolz. Wir müssen das<br />
anders als Andere tragen. Das ist eine Auszeichnung.“ 193<br />
Professor Kurt Huber wird nach der Rückkehr der Soldaten von der Ostfront in <strong>die</strong><br />
Flugblattaktionen eingeweiht. Nach der Niederlage bei Stalingrad entwarf Hans mit<br />
ihm das sechste und letzte Flugblatt der „Weißen Rose“. Hans Scholl wurde zusammen<br />
mit seiner Schwester Sophie am 18. Februar 1943 beim Verteilen der<br />
189 Herausgeber der katholischen Kulturzeitschrift „Hochland“.<br />
190 Steffahn (1993): 50<br />
191 Steffahn (1993): 53<br />
192 Steffahn (1993): 81<br />
193 Steffahn (1993): 84<br />
156