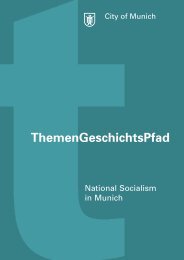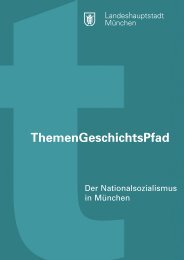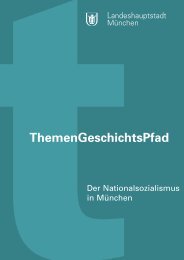Mahnmale, Gedenkstätten, Erinnerungsorte für die Opfer des ...
Mahnmale, Gedenkstätten, Erinnerungsorte für die Opfer des ...
Mahnmale, Gedenkstätten, Erinnerungsorte für die Opfer des ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
irgt. Resten eines zerstörten Tempels gleich erinnert es eindringlich daran, daß<br />
an <strong>die</strong>sem Ort <strong>die</strong> Hauptsynagoge Münchens stand.“<br />
GESCHICHTLICHER HINTERGRUND UND DEUTUNG<br />
Auf dem im Jahre 1882 von der Jüdischen Gemeinde Münchens erworbenen Gelände<br />
an der Maxburg-/Herzog-Max-/-Kapellenstraße entstand in den Jahren 1884-<br />
1887 <strong>die</strong> Synagoge. Ihr Architekt war Albert Schmidt (1841-1913). Über Größe<br />
und Fassungsvermögen <strong>des</strong> Baues im spätromanischen Stil schrieb der Kunsthistoriker<br />
K. E. O. Fritsch 1888: „ Der Grundriß <strong>des</strong> Hallenraumes hat <strong>die</strong> Form eines<br />
Quadrats von 31m Länge erhalten, das Mittelschiff eine Gesamtlänge von nahezu<br />
50m. Bei einer Gesamtzahl von 1000 Männer- und 800 Frauen- Sitzen nimmt <strong>die</strong><br />
neue Münchner Synagoge ihrer Größe nach <strong>die</strong> dritte Stelle in Deutschland ein.<br />
Sie wird übertroffen nur von der großen Berliner Synagoge, <strong>die</strong> <strong>für</strong> 1800 Männer<br />
und 1200 Frauen Platz gewährt, und von der Breslauer Synagoge, <strong>die</strong> jedoch nur<br />
50 Männersitze mehr zählt.“ 235<br />
Über <strong>die</strong> äußere Erscheinung und <strong>die</strong> Eingliederung in das Münchner Stadtbild<br />
schrieb Fritsch: „Das Bild der Synagoge in Zusammenstellung mit den hinter ihr<br />
aufragenden Thürmen der Frauenkirche, mit der Herzog Max Burg und dem an<br />
der Kapellenstraße liegenden Flügel <strong>des</strong> ehemaligen Jesuiten-Kollegiums (jetzt<br />
Akademiegebäu<strong>des</strong>). Nicht wie ein Eindringling innerhalb seiner Umgebung, sondern<br />
wie <strong>die</strong> von jeher beabsichtigte, endlich zur Ausführung gelangte Ergänzung<br />
<strong>des</strong> betreffenden Stadtbil<strong>des</strong> tritt <strong>die</strong> Synagoge in <strong>die</strong>ser Ansicht dem Beschauer<br />
entgegen“. Die Wirkung <strong>des</strong> Innenraumes: „Höhe und Breite der Schiffe, sowie<br />
Jochweiten und Emporen-Höhen sind aufs Glücklichste gegeneinander abgewogen<br />
…. ‚<strong>die</strong> fünfschiffige Halle‘ kommt in ihrem Eindruck durchaus als einheitlicher<br />
Raum zur Geltung.“ 236 Darauf abgestimmt war ebenfalls <strong>die</strong> Raumausstattung.<br />
„Die edle Wirkung <strong>des</strong> Raumes wird gesteigert durch <strong>die</strong> aus ge<strong>die</strong>genem Material<br />
hergestellte Einrichtung. Die aus verschiedenartigen Marmor gebildeten Säulen,<br />
Stufen, Umkleidungen, <strong>die</strong> reichen Metallbeschläge der Türen, der bronzenen<br />
Leuchter betonen eindrucksvoll <strong>die</strong> Ostwand mit heiliger Lade, Estrade und Kanzel.“<br />
237<br />
Über <strong>die</strong> Baugeschichte informierten zwei Marmortafeln: „Der Bau <strong>die</strong>ser Synagoge<br />
wurde i. J. 1884 unter der Regierung weiland S. M. <strong>des</strong> Königs Ludwig II.<br />
von Bayern begonnen und i. J. 1887 unter der Regierung S. Kgl. Hoheit <strong>des</strong> Prinzen<br />
Luitpold, als <strong>des</strong> Königreichs Bayern Verweser, vollendet. Die Einweihung<br />
235 Fritsch, K. E. O. (1988): Die neue Synagoge in München: 131-132<br />
236 Fritsch, K. E. O. (1888): Die neue Synagoge in München: 136-141<br />
237 Lamm, Hans (1969): Die Geschichte der Hauptsynagoge: 441<br />
187