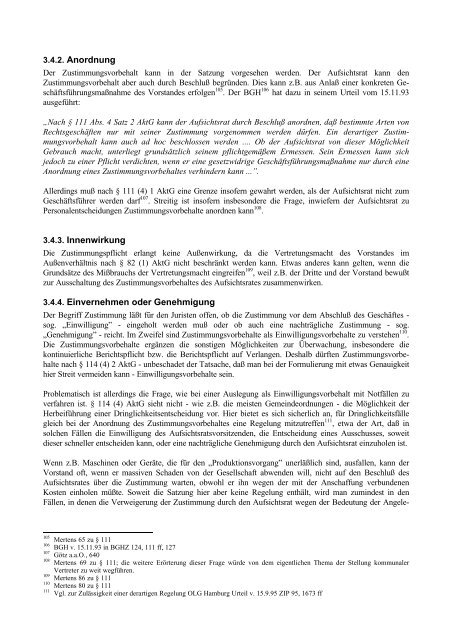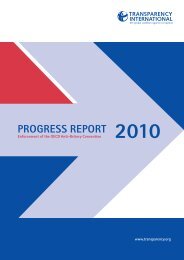Kommunale Aufsichtsratsmitglieder: Rechte, Pflichten, Haftung
Kommunale Aufsichtsratsmitglieder: Rechte, Pflichten, Haftung
Kommunale Aufsichtsratsmitglieder: Rechte, Pflichten, Haftung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
3.4.2. Anordnung<br />
Der Zustimmungsvorbehalt kann in der Satzung vorgesehen werden. Der Aufsichtsrat kann den<br />
Zustimmungsvorbehalt aber auch durch Beschluß begründen. Dies kann z.B. aus Anlaß einer konkreten Geschäftsführungsmaßnahme<br />
des Vorstandes erfolgen 105 . Der BGH 106 hat dazu in seinem Urteil vom 15.11.93<br />
ausgeführt:<br />
„Nach § 111 Abs. 4 Satz 2 AktG kann der Aufsichtsrat durch Beschluß anordnen, daß bestimmte Arten von<br />
Rechtsgeschäften nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen. Ein derartiger Zustimmungsvorbehalt<br />
kann auch ad hoc beschlossen werden .... Ob der Aufsichtsrat von dieser Möglichkeit<br />
Gebrauch macht, unterliegt grundsätzlich seinem pflichtgemäßem Ermessen. Sein Ermessen kann sich<br />
jedoch zu einer Pflicht verdichten, wenn er eine gesetzwidrige Geschäftsführungsmaßnahme nur durch eine<br />
Anordnung eines Zustimmungsvorbehaltes verhindern kann ...”.<br />
Allerdings muß nach § 111 (4) 1 AktG eine Grenze insofern gewahrt werden, als der Aufsichtsrat nicht zum<br />
Geschäftsführer werden darf 107 . Streitig ist insofern insbesondere die Frage, inwiefern der Aufsichtsrat zu<br />
Personalentscheidungen Zustimmungsvorbehalte anordnen kann 108 .<br />
3.4.3. Innenwirkung<br />
Die Zustimmungspflicht erlangt keine Außenwirkung, da die Vertretungsmacht des Vorstandes im<br />
Außenverhältnis nach § 82 (1) AktG nicht beschränkt werden kann. Etwas anderes kann gelten, wenn die<br />
Grundsätze des Mißbrauchs der Vertretungsmacht eingreifen 109 , weil z.B. der Dritte und der Vorstand bewußt<br />
zur Ausschaltung des Zustimmungsvorbehaltes des Aufsichtsrates zusammenwirken.<br />
3.4.4. Einvernehmen oder Genehmigung<br />
Der Begriff Zustimmung läßt für den Juristen offen, ob die Zustimmung vor dem Abschluß des Geschäftes -<br />
sog. „Einwilligung” - eingeholt werden muß oder ob auch eine nachträgliche Zustimmung - sog.<br />
„Genehmigung” - reicht. Im Zweifel sind Zustimmungsvorbehalte als Einwilligungsvorbehalte zu verstehen 110 .<br />
Die Zustimmungsvorbehalte ergänzen die sonstigen Möglichkeiten zur Überwachung, insbesondere die<br />
kontinuierliche Berichtspflicht bzw. die Berichtspflicht auf Verlangen. Deshalb dürften Zustimmungsvorbehalte<br />
nach § 114 (4) 2 AktG - unbeschadet der Tatsache, daß man bei der Formulierung mit etwas Genauigkeit<br />
hier Streit vermeiden kann - Einwilligungsvorbehalte sein.<br />
Problematisch ist allerdings die Frage, wie bei einer Auslegung als Einwilligungsvorbehalt mit Notfällen zu<br />
verfahren ist. § 114 (4) AktG sieht nicht - wie z.B. die meisten Gemeindeordnungen - die Möglichkeit der<br />
Herbeiführung einer Dringlichkeitsentscheidung vor. Hier bietet es sich sicherlich an, für Dringlichkeitsfälle<br />
gleich bei der Anordnung des Zustimmungsvorbehaltes eine Regelung mitzutreffen 111 , etwa der Art, daß in<br />
solchen Fällen die Einwilligung des Aufsichtsratsvorsitzenden, die Entscheidung eines Ausschusses, soweit<br />
dieser schneller entscheiden kann, oder eine nachträgliche Genehmigung durch den Aufsichtsrat einzuholen ist.<br />
Wenn z.B. Maschinen oder Geräte, die für den „Produktionsvorgang” unerläßlich sind, ausfallen, kann der<br />
Vorstand oft, wenn er massiven Schaden von der Gesellschaft abwenden will, nicht auf den Beschluß des<br />
Aufsichtsrates über die Zustimmung warten, obwohl er ihn wegen der mit der Anschaffung verbundenen<br />
Kosten einholen müßte. Soweit die Satzung hier aber keine Regelung enthält, wird man zumindest in den<br />
Fällen, in denen die Verweigerung der Zustimmung durch den Aufsichtsrat wegen der Bedeutung der Angele-<br />
105<br />
Mertens 65 zu § 111<br />
106<br />
BGH v. 15.11.93 in BGHZ 124, 111 ff, 127<br />
107<br />
Götz a.a.O., 640<br />
108<br />
Mertens 69 zu § 111; die weitere Erörterung dieser Frage würde von dem eigentlichen Thema der Stellung kommunaler<br />
Vertreter zu weit wegführen.<br />
109<br />
Mertens 86 zu § 111<br />
110<br />
Mertens 80 zu § 111<br />
111<br />
Vgl. zur Zulässigkeit einer derartigen Regelung OLG Hamburg Urteil v. 15.9.95 ZIP 95, 1673 ff