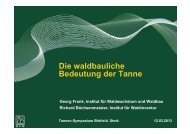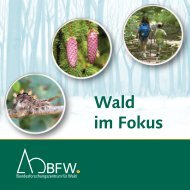- Seite 1 und 2:
Lexikon Waldschädigende Luftverunr
- Seite 3 und 4:
Ablagerung: >> Deposition. Abscisin
- Seite 5 und 6:
Äquivalentleitfähigkeit: Elektris
- Seite 7 und 8:
Aktionswert: Immissionswert, der du
- Seite 9 und 10:
Alphastrahlung: Korpuskularstrahlun
- Seite 11 und 12:
Konzentrationen in nassen Niedersch
- Seite 13 und 14:
Anpassungsmaßnahmen: A. an Immissi
- Seite 15 und 16:
Aphizid: Mittel gegen Blattläuse.
- Seite 17 und 18:
Zusammensetzung der reinen Atmosph
- Seite 19 und 20:
• Boden (Leaching): Die A. von N
- Seite 21 und 22:
BACHARACH-Skala: (Rußzahl-Skala):
- Seite 23 und 24:
• Buchensterben tritt zeitweilig
- Seite 25 und 26: Benadelungsdichte: Triebbiometrisch
- Seite 27 und 28: Beta-Strahlung: Positive oder negat
- Seite 29 und 30: Bioindikation, cytogenetische: (CGB
- Seite 31 und 32: Reaktions- und Akkumulations-Bioind
- Seite 33 und 34: Biotisch: Unter Mitbeteiligung lebe
- Seite 35 und 36: Blattrandnekrose: Auf den Bereich d
- Seite 37 und 38: Bodenatmung: Mikrobielle Freisetzun
- Seite 39 und 40: Bodenluft: Im Bodenkörper enthalte
- Seite 41 und 42: Bohrkerne: • Mit einem Hohlbohrer
- Seite 43 und 44: Cadmium: Stark toxisches, von Organ
- Seite 45 und 46: Chlordan: Chlorierter Kohlenwassers
- Seite 47 und 48: Chlorwasserstoff: Chemische Formel
- Seite 49 und 50: Cobalt: Schwermetall, chemisches Ze
- Seite 51 und 52: Dalapon: Natriumsalz der 2,2-Dichlo
- Seite 53 und 54: Die Depositionsgeschwindigkeit hän
- Seite 55 und 56: Dibenzofurane, polychlorierte: (PCD
- Seite 57 und 58: Diversität: Zahl der Arten und der
- Seite 59 und 60: Duftbruch: Abbrechen von Zweigen un
- Seite 61 und 62: Eisen: Mikronährstoff, chemisches
- Seite 63 und 64: Emissionsfaktoren: Allg.: Emissions
- Seite 65 und 66: Empfindlichkeit: Maß für die Reak
- Seite 67 und 68: Beispiele für Reaktionen verschied
- Seite 69 und 70: Esterasen: >> Enzyme. Ethen: (Äthy
- Seite 71 und 72: Fahnenkrone: Einseitige Entnadelung
- Seite 73 und 74: Filterwirkung des Waldes: Sammelbeg
- Seite 75: Fluor: Gasförmiges, sehr reaktions
- Seite 79 und 80: Auswirkungen auf unterschiedliche B
- Seite 81 und 82: Fosamin-Ammoniumsalz (Fosamine): Bl
- Seite 83 und 84: GAMMA: (Lindan): Bezeichnung für d
- Seite 85 und 86: Gesamtsäulenozon: Gesamtes O 3 in
- Seite 87 und 88: Glockenmethode: Integrierende Lufts
- Seite 89 und 90: Grenzschichtwiderstand: >> Depositi
- Seite 91 und 92: WHO 1995 (Leitwert) Schweizerische
- Seite 93 und 94: Grenzwerte für Ozon (µg m -3 ) 0,
- Seite 95 und 96: Weitere Grenzwerte für gasförmige
- Seite 97 und 98: Grundbelastung: (Vorbelastung): (Mi
- Seite 99 und 100: Konzentrationen, atmosphärische Le
- Seite 101 und 102: Histochemie: Wissenschaftszweig, de
- Seite 103 und 104: Hydroxysulfonate: Enzymhemmende Rea
- Seite 105 und 106: Immissionseinwirkung: Übertritt vo
- Seite 107 und 108: Gase Volumen- Mischungsverhältnis
- Seite 109 und 110: Dendrometrische Verfahren: • Verg
- Seite 111 und 112: Immobilisierung: Unlöslichmachen v
- Seite 113 und 114: Insektizide: Insektentötende Mitte
- Seite 115 und 116: Isoprenoide: Naturstoffe mit Isopre
- Seite 117 und 118: Jahrring: Zuwachsschicht, die im Ho
- Seite 119 und 120: Kammereffekt: Unerwünschter Effekt
- Seite 121 und 122: Klärschlämme: Aus Abwasserreinigu
- Seite 123 und 124: Kohlendioxid: Natürlicher, essenti
- Seite 125 und 126: • Anthropogene Quellen: Verbrennu
- Seite 127 und 128:
Korrosion: Im Zusammenhang mit (aku
- Seite 129 und 130:
Kronenraumbilanz: Differenz aus Bes
- Seite 131 und 132:
Kutikula: (Cuticula): Dünner, hydr
- Seite 133 und 134:
LAMBERT-BEERsches Gesetz: Grundgese
- Seite 135 und 136:
Lichtstreß-Index: >> Streßindices
- Seite 137 und 138:
Luftbildinventur: Luftbildgestützt
- Seite 139 und 140:
Konzentrationsbereiche und Expositi
- Seite 141 und 142:
• Registrierende Messungen: Die M
- Seite 143 und 144:
Manuelle bzw. integrierende Konzent
- Seite 145 und 146:
Eigenschaften von Spurenstoffen Kom
- Seite 147 und 148:
Gemessene und phytotoxische VOC-Kon
- Seite 149 und 150:
Magnesium: Hauptnährstoff (chemisc
- Seite 151 und 152:
MAST-Recorder: Vom VDI genormtes mi
- Seite 153 und 154:
Metallothioneine: Niedermolekulare,
- Seite 155 und 156:
Globale Methanemissionen (zitiert i
- Seite 157 und 158:
MIK-Werte nach VDI-Richtlinen 2310
- Seite 159 und 160:
Monitoringnetze, österreichische:
- Seite 161 und 162:
Mykorrhizen: (“Pilzwurzeln”): P
- Seite 163 und 164:
Nadellänge: Durchschnittliche Län
- Seite 165 und 166:
Hauptnährstoff-Mangelsymptome Haup
- Seite 167 und 168:
NaTA: Abkürzung für das Natriumsa
- Seite 169 und 170:
Nickel: Toxisches Schwermetall (che
- Seite 171 und 172:
NOx: Summe aus NO und NO 2. Vgl. >>
- Seite 173 und 174:
Ökotyp: (Standortsrasse): Durch be
- Seite 175 und 176:
Messung in der Luft: Integrierende
- Seite 177 und 178:
O 3-Nettoproduktion tritt nur in An
- Seite 179 und 180:
Parameter, bodenbiologische: >> Bas
- Seite 181 und 182:
Peroxide: Reaktive Verbindungen mit
- Seite 183 und 184:
Pflanzenanalyse: Chemische Analyse
- Seite 185 und 186:
Pflanzenphysiologische Untersuchung
- Seite 187 und 188:
Phloemnekrosen: Nekrotische Veränd
- Seite 189 und 190:
Photooxidantienhypothese: >> Waldst
- Seite 191 und 192:
Phytotoxizitätstests: Tests, mit d
- Seite 193 und 194:
Plasmolyse: Abheben des Protoplaste
- Seite 195 und 196:
Probenahme, extraktive: Abtrennung
- Seite 197 und 198:
Punktierung: (Sprenkelung): Schadsy
- Seite 199 und 200:
Quellengruppen (LAHMANN 1991) Emiss
- Seite 201 und 202:
Quenching: Verfall des angeregten Z
- Seite 203 und 204:
Radiosonde: Ballongetragener Radios
- Seite 205 und 206:
Rauhigkeit, aerodynamische: Die Mer
- Seite 207 und 208:
Österreichische Bundesgesetze (Aus
- Seite 209 und 210:
Wien Wiener Feuerpolizei- und Luftr
- Seite 211 und 212:
Remote sensing: Analyse von Landsch
- Seite 213 und 214:
Reservoirschicht: >> Atmosphäre. R
- Seite 215 und 216:
Ruheperiode: >> Vegetationsruhe. Ru
- Seite 217 und 218:
Salpetersäure: Starke anorganische
- Seite 219 und 220:
Schadstoff: Substanz mit schädigen
- Seite 221 und 222:
SCHOLANDER-Bombe: Gerät zur Messun
- Seite 223 und 224:
Die Bildung des “sauren Regens”
- Seite 225 und 226:
Empfindlichkeit von Bäumen: (RANFT
- Seite 227 und 228:
• Wirkung auf Zell-, Organ- und O
- Seite 229 und 230:
Schwermetalle im Boden: • Kaum vo
- Seite 231 und 232:
Selbstreinigungsvorgänge der Atmos
- Seite 233 und 234:
Smog: (Rauchnebel): Wortbildung aus
- Seite 235 und 236:
Spezifität: S. im Zusammenhang mit
- Seite 237 und 238:
Standardbedingungen: Luftvolumen (m
- Seite 239 und 240:
Wirkungen über den Boden: • Anre
- Seite 241 und 242:
Globale NOx- und N2O-Emissionen (Mi
- Seite 243 und 244:
Quellen und Senken: • Natürliche
- Seite 245 und 246:
Storchennestkrone: Durch vermindert
- Seite 247 und 248:
Streß, biotischer: Durch Lebewesen
- Seite 249 und 250:
Streßindices: (Kimastreßindices):
- Seite 251 und 252:
Wirkungen auf Pflanzen: Salzübersc
- Seite 253 und 254:
Symptom: (Anzeichen): Mehr oder wen
- Seite 255 und 256:
Symptomatologie: Lehre von Schädig
- Seite 257 und 258:
Technische Anleitung Luft: (TA-Luft
- Seite 259 und 260:
Tetraethylblei: Für den Mensch hoc
- Seite 261 und 262:
Toxikologie: Wissenschaft von den G
- Seite 263 und 264:
Treibhauseffekt: Die Erscheinung, d
- Seite 265 und 266:
Trübungstest: (Härtel-Test): Unsp
- Seite 267 und 268:
Umkippen von Ökosystemen: Irrevers
- Seite 269 und 270:
Umwelttoxikologie: Teilbereich der
- Seite 271 und 272:
Vakuole: Mit Zellsaft gefüllter, v
- Seite 273 und 274:
Verfügbarkeit von Meßwerten: Proz
- Seite 275 und 276:
Violaxanthin: >> Pigmente. Vitalit
- Seite 277 und 278:
Globale Waldflächen und Waldanteil
- Seite 279 und 280:
Waldschaden-Beobachtungssystem: (WB
- Seite 281 und 282:
Folgen eines effektiven Waldsterben
- Seite 283 und 284:
Boden: Wasserbilanz aus Wasserzufuh
- Seite 285 und 286:
Winterhalbjahr: Nach der Zweiten Ve
- Seite 287 und 288:
Wuchsstoffe: Stoffe, die das Wachst
- Seite 289 und 290:
Zeaxanthin: >> Pigmente, >> Xanthop
- Seite 291 und 292:
Zweite Verordnung gegen forstschäd
- Seite 293 und 294:
Dässler H.G. 1991: Einfluß von Lu
- Seite 295 und 296:
Kellog W.W., Cadle R.D., Allen E.R.
- Seite 297 und 298:
Pollanschütz J., Kilian W., Neuman
- Seite 299 und 300:
World Health Organization 1987a: Ai
- Seite 301 und 302:
DIN Deutsche Industrienorm DKEG Dam
- Seite 303 und 304:
LFKW leichtflüchtige Fluorchlorkoh
- Seite 305 und 306:
SEM scanning electron microscopy; a
- Seite 307 und 308:
CHClF 2 H-FCKW 22 CH O 2 Formaldehy
- Seite 309 und 310:
St. Smidt: Lexikon forstschädliche
- Seite 311 und 312:
Anpassungsfähigkeit: adaptability
- Seite 313 und 314:
Blattrandeinrollung: rolling up of
- Seite 315 und 316:
Dünger: manures, fertilizer Düngu
- Seite 317 und 318:
Früherkennung: early diagnosis Fr
- Seite 319 und 320:
Immissionsschädigung: injury by ai
- Seite 321 und 322:
Kurztrieb: brachy blast Kurzzeitbio
- Seite 323 und 324:
Mittelwert: average value Mittelwer
- Seite 325 und 326:
Pestizid: pesticide Pestizidrückst
- Seite 327 und 328:
Resistenz, genotypisch festgelegte:
- Seite 329 und 330:
Stickstoffdioxid: nitrogen dioxide
- Seite 331 und 332:
Umrechnungsfaktor: conversion facto
- Seite 333 und 334:
X Xanthophyll: xanthophyll Xenobiot
- Seite 335 und 336:
alcoxy radical: Alkoxylradikal alde
- Seite 337 und 338:
ushkiller: Arborizid bushy growth:
- Seite 339 und 340:
deficiency: Mangel deficiency disea
- Seite 341 und 342:
environmentally determined resistan
- Seite 343 und 344:
grass exposure method: Graskulturve
- Seite 345 und 346:
leaf conductance: Blattleitfähigke
- Seite 347 und 348:
nature conforming: naturnahe nearby
- Seite 349 und 350:
photochemical cycle: photolytischer
- Seite 351 und 352:
emote sensing: Fernerkundung repair
- Seite 353 und 354:
spray: Spray, Spritzmittel spreadin
- Seite 355:
value of assessment: Beurteilungswe





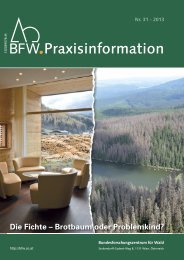








![pdf [7 MB] - BFW](https://img.yumpu.com/22350074/1/184x260/pdf-7-mb-bfw.jpg?quality=85)