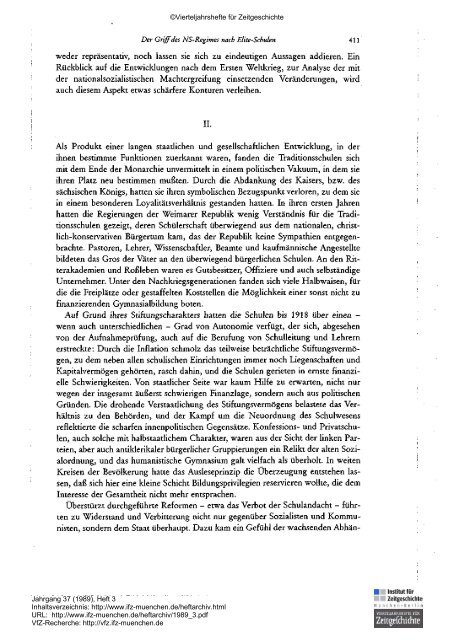Anhang - Institut für Zeitgeschichte
Anhang - Institut für Zeitgeschichte
Anhang - Institut für Zeitgeschichte
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Der Griff des NS-Regimes nach Elite-Schulen 411<br />
weder repräsentativ, noch lassen sie sich zu eindeutigen Aussagen addieren. Ein<br />
Rückblick auf die Entwicklungen nach dem Ersten Weltkrieg, zur Analyse der mit<br />
der nationalsozialistischen Machtergreifung einsetzenden Veränderungen, wird<br />
auch diesem Aspekt etwas schärfere Konturen verleihen.<br />
II.<br />
Als Produkt einer langen staatlichen und gesellschaftlichen Entwicklung, in der<br />
ihnen bestimmte Funktionen zuerkannt waren, fanden die Traditionsschulen sich<br />
mit dem Ende der Monarchie unvermittelt in einem politischen Vakuum, in dem sie<br />
ihren Platz neu bestimmen mußten. Durch die Abdankung des Kaisers, bzw. des<br />
sächsischen Königs, hatten sie ihren symbolischen Bezugspunkt verloren, zu dem sie<br />
in einem besonderen Loyalitätsverhältnis gestanden hatten. In ihren ersten Jahren<br />
hatten die Regierungen der Weimarer Republik wenig Verständnis <strong>für</strong> die Traditionsschulen<br />
gezeigt, deren Schülerschaft überwiegend aus dem nationalen, christlich-konservativen<br />
Bürgertum kam, das der Republik keine Sympathien entgegenbrachte.<br />
Pastoren, Lehrer, Wissenschaftler, Beamte und kaufmännische Angestellte<br />
bildeten das Gros der Väter an den überwiegend bürgerlichen Schulen. An den Ritterakademien<br />
und Roßleben waren es Gutsbesitzer, Offiziere und auch selbständige<br />
Unternehmer. Unter den Nachkriegsgenerationen fanden sich viele Halbwaisen, <strong>für</strong><br />
die die Freiplätze oder gestaffelten Koststellen die Möglichkeit einer sonst nicht zu<br />
finanzierenden Gymnasialbildung boten.<br />
Auf Grund ihres Stiftungscharakters hatten die Schulen bis 1918 über einen -<br />
wenn auch unterschiedlichen - Grad von Autonomie verfügt, der sich, abgesehen<br />
von der Aufnahmeprüfung, auch auf die Berufung von Schulleitung und Lehrern<br />
erstreckte: Durch die Inflation schmolz das teilweise beträchtliche Stiftungsvermögen,<br />
zu dem neben allen schulischen Einrichtungen immer noch Liegenschaften und<br />
Kapitalvermögen gehörten, rasch dahin, und die Schulen gerieten in ernste finanzielle<br />
Schwierigkeiten. Von staatlicher Seite war kaum Hilfe zu erwarten, nicht nur<br />
wegen der insgesamt äußerst schwierigen Finanzlage, sondern auch aus politischen<br />
Gründen. Die drohende Verstaatlichung des Stiftungsvermögens belastete das Verhältnis<br />
zu den Behörden, und der Kampf um die Neuordnung des Schulwesens<br />
reflektierte die scharfen innenpolitischen Gegensätze. Konfessions- und Privatschulen,<br />
auch solche mit halbstaatlichem Charakter, waren aus der Sicht der linken Parteien,<br />
aber auch antiklerikaler bürgerlicher Gruppierungen ein Relikt der alten Sozialordnung,<br />
und das humanistische Gymnasium galt vielfach als überholt. In weiten<br />
Kreisen der Bevölkerung hatte das Ausleseprinzip die Überzeugung entstehen lassen,<br />
daß sich hier eine kleine Schicht Bildungsprivilegien reservieren wollte, die dem<br />
Interesse der Gesamtheit nicht mehr entsprachen.<br />
Überstürzt durchgeführte Reformen - etwa das Verbot der Schulandacht - führten<br />
zu Widerstand und Verbitterung nicht nur gegenüber Sozialisten und Kommunisten,<br />
sondern dem Staat überhaupt. Dazu kam ein Gefühl der wachsenden Abhän-