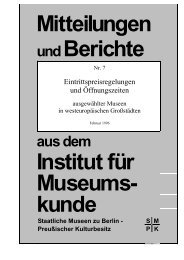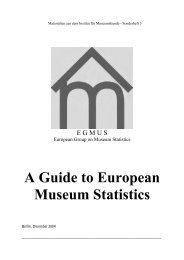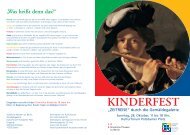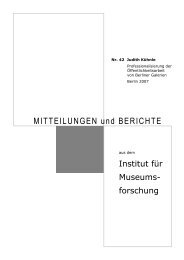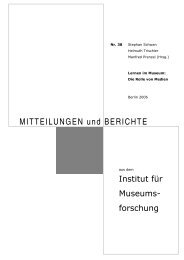MITTEILUNGEN und BERICHTE - Staatliche Museen zu Berlin
MITTEILUNGEN und BERICHTE - Staatliche Museen zu Berlin
MITTEILUNGEN und BERICHTE - Staatliche Museen zu Berlin
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Vor allem durch die Objektbezogenheit der <strong>Museen</strong>, im Gegensatz <strong>zu</strong>m Wort- <strong>und</strong><br />
Schriftunterricht der Schule, bietet sich Raum für handlungsorientierte <strong>und</strong> erfah-<br />
rungsorientierte Konzepte an. Auch das freiwillige Einlassen auf Lerninhalte kann<br />
im Museum berücksichtigt werden. Jeder Besucher entscheidet für sich, wie lange<br />
er sich wo aufhält <strong>und</strong> mit welchen Ausstellungsangeboten er sich auseinander-<br />
setzt. Durch ein offen konzipiertes Lernangebot können individuelle Bedürfnisse<br />
der Besucher, vor allem der Kinder, berücksichtigt werden.<br />
Das Museum kann so heut<strong>zu</strong>tage <strong>zu</strong> einem Ort werden, an dem nicht nur Informa-<br />
tionen vermittelt werden, sondern der auch der Erweiterung der eigenen Erfah-<br />
rungsbasis dient, der Anregungen (stimulation) gibt, Werte <strong>und</strong> Ideen (ethics) ver-<br />
mittelt, den Besucher da<strong>zu</strong> ermächtigt (empowerment), mit einem Objekt in Kon-<br />
versation <strong>zu</strong> treten, sich aktiv mit einer Botschaft auseinander<strong>zu</strong>setzen <strong>und</strong> sie<br />
nach eigener Einsicht <strong>zu</strong> interpretieren. 30 Aus dem passiven Besucher des traditio-<br />
nellen Museumsbegriffes wird ein aktiver K<strong>und</strong>e, aus dem „Tempel“ <strong>und</strong> „Objekt-<br />
speicher“ Museum werden aktive Lernumwelten für Menschen.<br />
1.3.2 Jean Piaget <strong>und</strong> Einflüsse aus der Spielpädagogik<br />
In naher Verwandtschaft <strong>zu</strong>r Reformpädagogik entwickelten sich besonders Anfang<br />
des 20sten Jahrh<strong>und</strong>erts neue spielpädagogische Ansätze, die gegen Ende der<br />
60er <strong>und</strong> in den 70er Jahren im Zuge der Vorschulerziehung wiederentdeckt wur-<br />
den <strong>und</strong> <strong>zu</strong> Beginn der 80er Jahre durch den Boom der kulturellen, außerschuli-<br />
schen Bildung einen neuen Aufschwung erlebten. 31 Besonders Jean Piagets (1896 -<br />
1980) Forschungen <strong>zu</strong> kognitiven Spieltheorien, die die spielerische Auseinander-<br />
set<strong>zu</strong>ng von Kindern mit ihrer Umwelt thematisieren, beeinflussten die museums-<br />
pädagogische Entwicklung der Kinder- <strong>und</strong> Jugendmuseen. Im experimentellen<br />
<strong>und</strong> kreativen Spiel sammeln Kinder Erfahrungen über ihre Umwelt, sie lernen,<br />
verstehen, verinnerlichen. Dabei setzt Piaget verschiedene Phasen der Denk- <strong>und</strong><br />
Spielentwicklung des Kindes voraus, die miteinander verknüpft sind <strong>und</strong> je nach<br />
Alter des Kindes parallel verlaufen. 32 In Be<strong>zu</strong>g auf die heutige Ausstellungsdidaktik<br />
<strong>und</strong> -konzeption werden aus der Spieltheorie vor allem verschiedene Spielformen<br />
wie Rollenspiele, Forscherspiele, Lernspiele, etc. angewandt. Spielen beinhaltet<br />
also auch aktives Experimentieren, Ausprobieren <strong>und</strong> Reflektieren. Das Lernen im<br />
Spiel ist eine Aneignungsform im Museum, die kindlichen Bedürfnissen entgegen-<br />
kommt <strong>und</strong> den Zugang <strong>zu</strong> Ausstellungsthemen erleichtert. Vor allem macht diese<br />
30 Lisa C. Roberts nennt in Be<strong>zu</strong>g auf die Erziehungsaufgabe des Museums vier Kernfunktionen:<br />
entertainment, empowerment, experience, ethics. Roberts, 1997, S.131.<br />
31 Vor allem die Anregungen Fröbels, der als erster Pädagoge das Spiel hoch eingeschätzt hatte <strong>und</strong> die<br />
Aufgabe des Erziehers „Spielpflege“ genannt hatte, wurden von vielen Reformern, u.a. Ellen Key,<br />
Maria Montessori, Gurlitt, Scharrelmann <strong>und</strong> Berthold Otto, aufgegriffen, neu belebt <strong>und</strong> weiter entwickelt.<br />
Vgl. auch Scheuerl, 1979, S.17 ff.<br />
32 Vgl. Hering, 1979, S.28 f.<br />
21