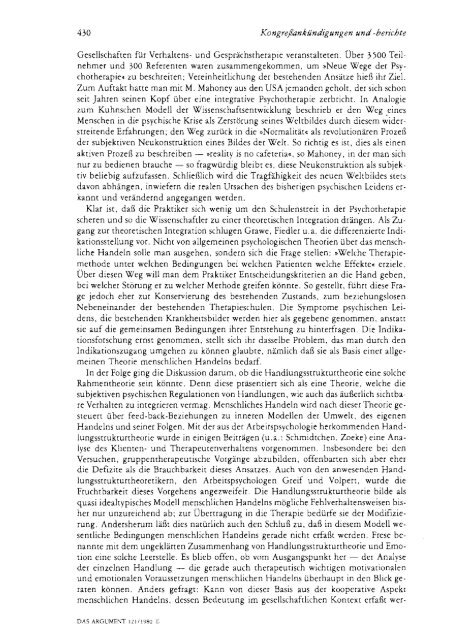Westeuropäische Linke und "dritter Weg" - Berliner Institut für ...
Westeuropäische Linke und "dritter Weg" - Berliner Institut für ...
Westeuropäische Linke und "dritter Weg" - Berliner Institut für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
430 Kongreßankündigungen <strong>und</strong> -benchte<br />
Gesellschaften <strong>für</strong> Verhaltens- <strong>und</strong> Gesprächstherapie veranstalteten. Über 3500 Teilnehmer<br />
<strong>und</strong> 300 Referenten waren zusammengekommen, um »Neue Wege der Psychotherapie.<br />
zu beschreiten; Vereinheitlichung der bestehenden Ansätze hieß ihr Ziel.<br />
Zum Auftakt hatte man mit M. Mahoney aus den USA jemanden geholt, der sich schon<br />
seit Jahren seinen Kopf über eine integrative Psychotherapie zerbricht. In Analogie<br />
zum Kuhnschen Modell der Wissenschaftsentwicklung beschrieb er den Weg eines<br />
Menschen in die psychische Krise als Zerstörung seines Weltbildes durch diesem ~iderstreitende<br />
Erfahrungen; den Weg zurück in die »Normalität« als revolutionären Prozeß<br />
der subjektiven Neukonstruktion eines Bildes der Welt. So richtig es ist, dies als einen<br />
aktiven Prozeß zu beschreiben - »reality is no cafeteria«, so Mahoney, in der man sich<br />
nur zu bedienen brauche - so fragwürdig bleibt es, diese Neukonstfuktion als subjektiv<br />
beliebig aufzufassen. Schließlich wird die Tragfähigkeit des neuen Weltbildes stets<br />
davon abhängen, inwiefern die realen Ursachen des bisherigen psychischen Leidens erkannt<br />
<strong>und</strong> verändernd angegangen werden.<br />
Klar ist, daß die Praktiker sich wenig um den Schulenstreit in der Psychotherapie<br />
scheren <strong>und</strong> so die Wissenschaftler zu einer theoretischen Integration drängen. Als Zugang<br />
zur theoretischen Integration schlugen Grawe, Fiedler u. a. die differenzierte Indikationsstellung<br />
vor. Nicht von allgemeinen psychologischen Theorien über das menschliche<br />
Handeln solle man ausgehen, sondern sich die Frage stellen: »Welche Therapiemethode<br />
unter welchen Bedingungen bei welchen Patienten welche Effekte« erziele.<br />
Über diesen Weg will man dem Praktiker Entscheidungskriterien an die Hand geben,<br />
bei welcher Störung er zu welcher Methode greifen könnte. So gestellt, führt diese Frage<br />
jedoch eher zur Konservierung des bestehenden Zustands, zum beziehungslosen<br />
Nebeneinander der bestehenden Therapieschulen. Die Symptome psychischen Leidens,<br />
die bestehenden Krankheitsbilder werden hier als gegebene genommen. anstatt<br />
sie auf die gemeinsamen Bedingungen ihrer Entstehung zu hinterfragen. Die Indikationsforschung<br />
ernst genommen, stellt sich ihr dasselbe Problem, das man durch den<br />
Indikationszugang umgehen zu können glaubte, nämlich daß sie als Basis einer allgemeinen<br />
Theorie menschlichen Handelns bedarf.<br />
In der Folge ging die Diskussion darum, ob die Handlungsstfukturtheorie eine solche<br />
Rahmentheorie sein könnte. Denn diese präsentiert sich als eine Theorie, welche die<br />
subjektiven psychischen Regulationen von Handlungen, wie auch das äußerlich sichtbare<br />
Verhalten zu integrieren vermag. Menschliches Handeln wird nach dieser Theorie gesteuert<br />
über feed-back-Beziehungen zu inneren Modellen der Umwelt, des eigenen<br />
Handelns <strong>und</strong> seiner Folgen. Mit der aus der Arbeitspsychologie herkommenden Handlungsstrukturtheorie<br />
wurde in einigen Beiträgen (u.a.: Schmidtchen, Zoeke) eine Analyse<br />
des Klienten- <strong>und</strong> Therapeutenverhaltens vorgenommen. Insbesondere bei den<br />
Versuchen, gruppentherapeutische Vorgänge abzubilden, offenbarten sich aber eher<br />
die Defizite als die Brauchbarkeit dieses Ansatzes. Auch von den anwesenden Handlungsstrukturtheoretikern,<br />
den Arbeitspsychologen Greif <strong>und</strong> Volpert, wurde die<br />
Fruchtbarkeit dieses Vorgehens angezweifelt. Die Handlungsstrukturtheorie bilde als<br />
quasi idealtypisches Modell menschlichen Handelns mögliche Fehlverhaltensweisen bisher<br />
nur unzureichend ab; zur Übertragung in die Therapie bedürfe sie der Modifizierung.<br />
Andersherum läßt dies natürlich auch den Schluß zu, daß in diesem Modell wesentliche<br />
Bedingungen menschlichen Handeins gerade nicht erfaßt werden. Frese benannte<br />
mit dem ungeklärten Zusammenhang von Handlungsstrukturtheorie <strong>und</strong> Emotion<br />
eine solche Leerstelle. Es blieb offen, ob vom Ausgangspunkt her - der Analyse<br />
der einzelnen Handlung - die gerade auch therapeutisch wichtigen motivationalen<br />
<strong>und</strong> emotionalen Voraussetzungen menschlichen Handeins überhaupt in den Blick geraten<br />
können. Anders gefragt: Kann von dieser Basis aus der kooperative Aspekt<br />
menschlichen Handelns, dessen Bedeutung im gesellschaftlichen Kontext erfaßt wer-<br />
DAS ARGUMEl'.'T 121/1980