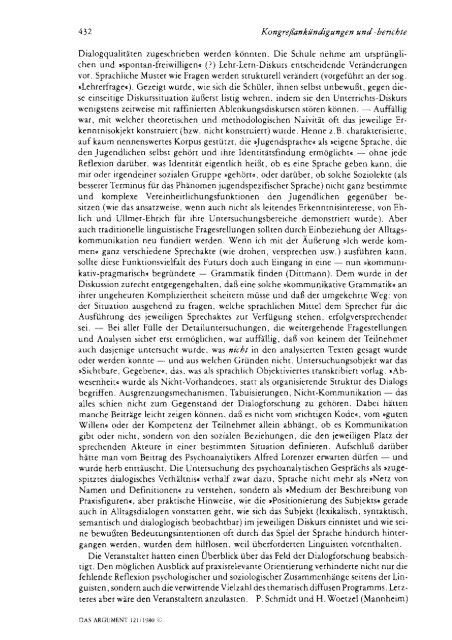Westeuropäische Linke und "dritter Weg" - Berliner Institut für ...
Westeuropäische Linke und "dritter Weg" - Berliner Institut für ...
Westeuropäische Linke und "dritter Weg" - Berliner Institut für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
432 Kongreßankündigungen <strong>und</strong> -benchte<br />
Dialogqualitäten zugeschrieben werden könnten. Die Schule nehme am ursprünglichen<br />
<strong>und</strong> .spontan-freiwilligen. (?) Lehr-Lern-Diskurs entscheidende Veränderungen<br />
vor. Sprachliche Muster wie Fragen werden strukturell verändert (vorgeführt an der sog .<br />
• Lehrerfrage.). Gezeigt wurde, wie sich die Schüler, ihnen selbst unbewußt, gegen diese<br />
einseitige Diskurssituation äußerst listig wehren, indem sie den Unterrichts-Diskurs<br />
wenigstens zeitweise mit raffinierten Ablenkungsdiskursen stören können. - Auffällig<br />
war, mit welcher theoretischen <strong>und</strong> methodologischen Naivität oft das jeweilige Erkenntnisokjekt<br />
konstruiert (bzw. nicht konstruiert) wurde. Henne z.B. charakterisierte,<br />
auf kaum nennenswertes Korpus gestützt, die .Jugendsprache« als .eigene Sprache, die<br />
den Jugendlichen selbst gehört <strong>und</strong> ihre Idemitätsfindung ermöglicht« - ohne jede<br />
Reflexion darüber, was Identität eigentlich heißt, ob es eine Sprache geben kann, die<br />
mir oder irgendeiner sozialen Gruppe »gehört«, oder darüber, ob solche Soziolekte (als<br />
besserer Terminus <strong>für</strong> das Phänomen jugendspezifischer Sprache) nicht ganz bestimmte<br />
<strong>und</strong> komplexe Vereinheitlichungsfunktionen den Jugendlichen gegenüber besitzen<br />
(wie das ansatzweise, wenn auch nicht als leitendes Erkenntnisinteresse, von Ehlich<br />
<strong>und</strong> Ullmer-Ehrich <strong>für</strong> ihre Untersuchungs bereiche demonstriert wurde). Aber<br />
auch traditionelle linguistische Fragestellungen sollten durch Einbeziehung der Alltagskommunikation<br />
neu f<strong>und</strong>iert werden. Wenn ich mit der Äußen.lOg »Ich werde kommen.<br />
ganz verschiedene Sprechakte (wie drohen, versprechen usw.) ausführen kann,<br />
sollte diese Funktionsvielfalt des Futurs doch auch Eingang in eine - nun .kommunikativ-pragmatisch.<br />
begründete - Grammatik finden (Dittmann). Dem wurde in der<br />
Diskussion zurecht entgegengehalten, daß eine solche .kommunikative Grammatik« an<br />
ihrer ungeheuren Kompliziertheit scheitern müsse <strong>und</strong> daß der umgekehrte Weg: von<br />
der Situation ausgehend zu fragen, welche sprachlichen Mittel dem Sprecher <strong>für</strong> die<br />
Ausführung des jeweiligen Sprechaktes zur Verfügung stehen, erfolgversprechender<br />
sei. - Bei aller Fülle der Detailuntersuchungen, die weitergehende Fragestellungen<br />
<strong>und</strong> Analysen sicher erst ermöglichen, war auffällig, daß von keinem der Teilnehmer<br />
auch dasjenige untersucht wurde, was nicht in den analysierten Texten gesagt wurde<br />
oder werden konnte - <strong>und</strong> aus welchen Gründen nicht. Untersuchungsobjekt war das<br />
.Sichtbare, Gegebene«, das, was als sprachlich Objektiviertes transkribiert vorlag .• Abwesenheit«<br />
wurde als Nicht-Vorhandenes, statt als organisierende Struktur des Dialogs<br />
begriffen. Ausgrenzungsmechanismen, Tabuisierungen, Nicht-Kommunikation - das<br />
alles schien nicht zum Gegenstand der Dialogforschung zu gehören. Dabei hätten<br />
manche Beiträge leicht zeigen können, daß es nicht vom »richtigen Kode«, vom .guten<br />
Willen. oder der Kompetenz der Teilnehmer allein abhängt, ob es Kommunikation<br />
gibt oder nicht, sondern von den sozialen Beziehungen, die den jeweiligen Platz der<br />
sprechenden Akteure in einer bestimmten Situation definieren. Aufschluß darüber<br />
hätte man vom Beitrag des Psychoanalytikers Alfred Lorenzer erwarten dürfen - <strong>und</strong><br />
wurde herb enttäuscht. Die Untersuchung des psychoanalytischen Gesprächs als .zugespitztes<br />
dialogisches Verhälrnis« verhalf zwar dazu, Sprache nicht mehr als .Netz von<br />
Namen <strong>und</strong> Definitionen« zu verstehen, sondern als .Medium der Beschreibung von<br />
Praxisfiguren«, aber praktische Hinweise, wie die .Positionierung des Subjekts. gerade<br />
auch in Alltagsdialogen vonstatten geht, wie sich das Subjekt (lexikalisch, syntaktisch,<br />
semantisch <strong>und</strong> dialoglogisch beobachtbar) im jeweiligen Diskurs einnistet <strong>und</strong> wie seine<br />
bewußten Bedeutungsintentionen oft durch das Spiel der Sprache hindurch hintergangen<br />
werden, wurden dem hilflosen, weil überforderten Linguisten vorenthalten.<br />
Die Veranstalter hatten einen Überblick über das Feld der Dialogforschung beabsichtigt.<br />
Den möglichen Ausblick auf praxisrelevante Orientierung verhinderte nicht nur die<br />
fehlende Reflexion psychologischer <strong>und</strong> soziologischer Zusammenhänge seitens der Linguisten,<br />
sondern auch die verwirrende Vielzahl des thematisch diffusen Programms. Letzteres<br />
aber wäre den Veranstaltern anzulasten. P. Schmidt <strong>und</strong> H. Woetzel (Mannheim)<br />
DAS ARGUMENT 12111980