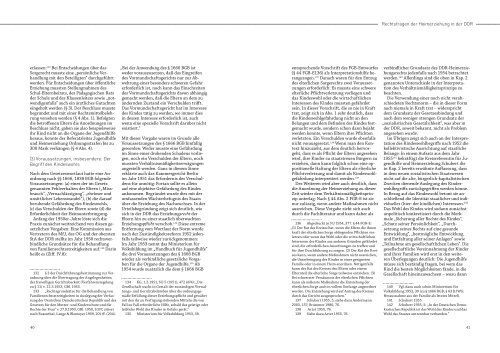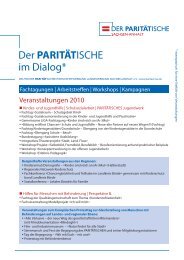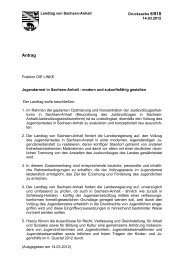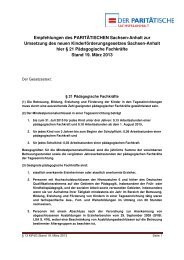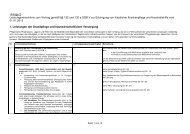Aufarbeitung der Heimerziehung in der DDR - Fonds Heimerziehung
Aufarbeitung der Heimerziehung in der DDR - Fonds Heimerziehung
Aufarbeitung der Heimerziehung in der DDR - Fonds Heimerziehung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Rechtsfragen <strong>der</strong> <strong>Heimerziehung</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>DDR</strong><br />
erlassen: 132 Bei Entscheidungen über das<br />
Sorgerecht musste e<strong>in</strong>e „persönliche Verhandlung<br />
mit den Beteiligten“ durchgeführt<br />
werden. Für Entscheidungen über öffentliche<br />
Erziehung mussten Stellungnahmen des<br />
Schul-Elternbeirats, des Pädagogischen Rats<br />
<strong>der</strong> Schule und des Klassenleiters sowie „notwendigenfalls“<br />
auch e<strong>in</strong> ärztliches Gutachten<br />
e<strong>in</strong>geholt werden (§ 3). Der Beschluss musste<br />
begründet und mit e<strong>in</strong>er Rechtsmittelbelehrung<br />
versehen werden (§ 4 Abs. 1). Befolgten<br />
die betroffenen Eltern die Anordnungen im<br />
Beschluss nicht, gaben sie also beispielsweise<br />
ihr K<strong>in</strong>d nicht an die Organe <strong>der</strong> Jugendhilfe<br />
heraus, konnte <strong>der</strong> Referatsleiter Jugendhilfe<br />
und <strong>Heimerziehung</strong> Ordnungsstrafen bis zu<br />
300 Mark verhängen (§ 4 Abs. 4).<br />
(3) Voraussetzungen, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e: Der<br />
Begriff des K<strong>in</strong>deswohls<br />
Nach dem Gesetzeswortlaut hatte e<strong>in</strong>e Anordnung<br />
nach §§ 1666, 1838 BGB folgende<br />
Voraussetzungen: (a) e<strong>in</strong>es <strong>der</strong> im Gesetz<br />
genannten Fehlverhalten <strong>der</strong> Eltern („Missbrauch“,<br />
„Vernachlässigung“, „ehrloser und<br />
unsittlicher Lebenswandel“), (b) die darauf<br />
beruhende Gefährdung des K<strong>in</strong>deswohls,<br />
(c) das Verschulden <strong>der</strong> Eltern sowie (d) die<br />
Erfor<strong>der</strong>lichkeit <strong>der</strong> Heimunterbr<strong>in</strong>gung.<br />
Anfang <strong>der</strong> 1950er-Jahre löste sich die<br />
Praxis zunächst weitreichend von diesen gesetzlichen<br />
Vorgaben: E<strong>in</strong>e Kommission aus<br />
Vertretern des MfJ, des OG und <strong>der</strong> obersten<br />
StA <strong>der</strong> <strong>DDR</strong> stellte im Jahr 1950 rechtsverb<strong>in</strong>dliche<br />
Grundsätze für die Behandlung<br />
von Familienrechtsstreitigkeiten auf. 133 Dar<strong>in</strong><br />
heißt es (Ziff. IV.8):<br />
132 § 3 <strong>der</strong> Durchführungsbestimmung zur Verordnung<br />
über die Übertragung <strong>der</strong> Angelegenheiten<br />
<strong>der</strong> freiwilligen Gerichtsbarkeit (Verfahrensregelung<br />
zu § 11) v. 12.3.1953, GBl. 1953.<br />
133 „Rechtsgrundsätze für die Behandlung von<br />
Familienrechtsstreitigkeiten <strong>in</strong> Auslegung <strong>der</strong> Verfassung<br />
<strong>der</strong> Deutschen Demokratischen Republik und des<br />
Gesetzes für den Mutter- und K<strong>in</strong><strong>der</strong>schutz und die<br />
Rechte <strong>der</strong> Frau“ v. 27.9.1950, GBl. 1950, 1037, zitiert<br />
nach Rosenthal, Lange & Blomeyer 1959, 201 ff. (204).<br />
„Bei <strong>der</strong> Anwendung des § 1666 BGB ist<br />
we<strong>der</strong> vorauszusetzen, daß das E<strong>in</strong>greifen<br />
des Vormundschaftsgerichts nur zur Abwehrung<br />
e<strong>in</strong>er beson<strong>der</strong>s schweren Gefahr<br />
erfor<strong>der</strong>lich ist, noch kann das E<strong>in</strong>schreiten<br />
des Vormundschaftsgerichts davon abhängig<br />
gemacht werden, daß die Eltern an dem zu<br />
än<strong>der</strong>nden Zustand e<strong>in</strong> Verschulden trifft.<br />
Das Vormundschaftsgericht hat im Interesse<br />
des K<strong>in</strong>des tätig zu werden, wo immer dies<br />
<strong>in</strong> dessen Interesse erfor<strong>der</strong>lich ist, auch<br />
wenn e<strong>in</strong>e spezielle Vorschrift darüber nicht<br />
existiert.“<br />
Mit dieser Vorgabe waren im Grunde alle<br />
Voraussetzungen des § 1666 BGB h<strong>in</strong>fällig<br />
geworden: We<strong>der</strong> musste e<strong>in</strong>e Gefährdung<br />
im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>es drohenden Schadens vorliegen,<br />
noch e<strong>in</strong> Verschulden <strong>der</strong> Eltern, noch<br />
mussten Verhältnismäßigkeitserwägungen<br />
angestellt werden. Ganz <strong>in</strong> diesem S<strong>in</strong>ne<br />
erklärte auch das Kammergericht Berl<strong>in</strong><br />
im Jahr 1951 das Erfor<strong>der</strong>nis des Verschuldens<br />
für unnötig: Fortan sollte es alle<strong>in</strong><br />
auf e<strong>in</strong>e objektive Gefährdung des K<strong>in</strong>des<br />
ankommen. Begründet wurde dies mit <strong>der</strong><br />
umfassenden Wächterbefugnis des Staats<br />
über die Erziehung des Nachwuchses. In <strong>der</strong><br />
Urteilsbegründung zeigt sich deutlich, wie<br />
sich <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>DDR</strong> das Erziehungsrecht <strong>der</strong><br />
Eltern h<strong>in</strong> zu e<strong>in</strong>er staatlich überwachten<br />
Erziehungspflicht verschob. 134 Diese extreme<br />
Entfernung vom Wortlaut <strong>der</strong> Norm wurde<br />
nach <strong>der</strong> Zuständigkeitsreform 1952 jedenfalls<br />
teilweise wie<strong>der</strong> zurückgenommen:<br />
Im Jahr 1953 nennt das M<strong>in</strong>isterium für<br />
Volksbildung im „Handbuch für Jugendhilfe“<br />
die drei Voraussetzungen des § 1666 BGB<br />
wie<strong>der</strong> als verb<strong>in</strong>dliche gesetzliche Vorgaben<br />
für die Organe <strong>der</strong> Jugendhilfe. 135 Ab<br />
1954 wurde zusätzlich die dem § 1666 BGB<br />
134 KG, 1.3.1951, NJ 5 (1951), 472 (474): „Die<br />
Gesellschaft wacht <strong>in</strong> Gestalt <strong>der</strong> zuständigen Verwaltungs-<br />
und Gerichtsbehörden über die ordnungsgemäße<br />
Erfüllung dieser Erziehungspflicht und gewährt<br />
mit den ihr zu Verfügung stehenden Mitteln die von<br />
Fall zu Fall erfor<strong>der</strong>liche Hilfe, sobald das geistige o<strong>der</strong><br />
leibliche Wohl des K<strong>in</strong>des <strong>in</strong> Gefahr gerät.“<br />
135 M<strong>in</strong>isterium für Volksbildung 1953, 58.<br />
entsprechende Vorschrift des FGB-Entwurfes<br />
(§ 44 FGB-E136) als Interpretationshilfe herangezogen.<br />
137 Danach waren für den Entzug<br />
des elterlichen Sorgerechts zwei Voraussetzungen<br />
erfor<strong>der</strong>lich: Es musste e<strong>in</strong>e schwere<br />
elterliche Pflichtverletzung vorliegen und<br />
das K<strong>in</strong>deswohl o<strong>der</strong> die wirtschaftlichen<br />
Interessen des K<strong>in</strong>des mussten gefährdet<br />
se<strong>in</strong>. In dieser Vorschrift, die so nie <strong>in</strong> Kraft<br />
trat, zeigt sich <strong>in</strong> Abs. 1 sehr deutlich, dass<br />
die K<strong>in</strong>deswohlgefährdung nicht an den<br />
Belangen und dem Bef<strong>in</strong>den des K<strong>in</strong>des festgemacht<br />
wurde, son<strong>der</strong>n schon dann bejaht<br />
werden konnte, wenn Eltern ihre Pflichten<br />
verletzten. E<strong>in</strong> Verschulden wurde ebenfalls<br />
nicht vorausgesetzt. 138 Wenn man den Kontext<br />
h<strong>in</strong>zuzieht, aus dem deutlich hervorgeht,<br />
dass es als Pflicht <strong>der</strong> Eltern angesehen<br />
wird, ihre K<strong>in</strong><strong>der</strong> zu staatstreuen Bürgern zu<br />
erziehen, dann kann folglich schon e<strong>in</strong>e oppositionelle<br />
Haltung <strong>der</strong> Eltern als elterliche<br />
Pflichtverletzung und damit als K<strong>in</strong>deswohlgefährdung<br />
<strong>in</strong>terpretiert werden. 139<br />
Des Weiteren wird aber auch deutlich, dass<br />
die Anordnung <strong>der</strong> <strong>Heimerziehung</strong> zu dieser<br />
Zeit wie<strong>der</strong> dem Verhältnismäßigkeitspr<strong>in</strong>zip<br />
unterlag: Nach § 44 Abs. 2 FGB-E ist sie<br />
nur zulässig, wenn an<strong>der</strong>e Maßnahmen nicht<br />
ausreichen. Diese Vorgabe zieht sich auch<br />
durch die Fachliteratur und kann daher als<br />
136 Abgedruckt <strong>in</strong> NJ 1954, 377. § 44 FGB-E:<br />
„(1) Der Rat des Kreises hat, wenn die Eltern die ihnen<br />
kraft <strong>der</strong> elterlichen Sorge obliegenden Pflichten verletzen<br />
o<strong>der</strong> wenn das Wohl o<strong>der</strong> die wirtschaftlichen<br />
Interessen des K<strong>in</strong>des aus an<strong>der</strong>en Gründen gefährdet<br />
s<strong>in</strong>d, die erfor<strong>der</strong>lichen Anordnungen zu treffen und<br />
für ihre Durchführung zu sorgen. (2) Der Rat des Kreises<br />
kann, wenn an<strong>der</strong>e Maßnahmen nicht ausreichen,<br />
die Unterbr<strong>in</strong>gung des K<strong>in</strong>des <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er geeigneten<br />
Familie o<strong>der</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Heim anordnen. Nötigenfalls<br />
kann <strong>der</strong> Rat des Kreises den Eltern o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>em<br />
Elternteil die elterliche Sorge teilweise entziehen. (3)<br />
Bei schwerster Versäumnis <strong>der</strong> elterlichen Pflichten<br />
kann als äußerste Maßnahme die Entziehung <strong>der</strong><br />
elterlichen Sorge auch <strong>in</strong> vollem Umfange angeordnet<br />
werden. Die Entziehung wird auf Antrag des Kreises<br />
durch das Gericht ausgesprochen.“<br />
137 Schubert 1955, 5; siehe dazu An<strong>der</strong>mann<br />
2003, 157; Brümmer 1980, 70.<br />
138 Artzt 1955, 76.<br />
139 Siehe dazu Artzt 1955, 76.<br />
verb<strong>in</strong>dlicher Grundsatz des <strong>DDR</strong>-<strong>Heimerziehung</strong>srechts<br />
jedenfalls nach 1954 betrachtet<br />
werden. 140 Allerd<strong>in</strong>gs s<strong>in</strong>d die oben <strong>in</strong> Kap. 2<br />
genannten Unterschiede <strong>in</strong> <strong>der</strong> Interpretation<br />
des Verhältnismäßigkeitspr<strong>in</strong>zips zu<br />
beachten.<br />
Die Verwendung e<strong>in</strong>er noch nicht verabschiedeten<br />
Rechtsnorm – die <strong>in</strong> dieser Form<br />
auch niemals <strong>in</strong> Kraft trat – wi<strong>der</strong>spricht<br />
dem Grundsatz <strong>der</strong> Gesetzesb<strong>in</strong>dung und<br />
auch dem weniger strengen Grundsatz <strong>der</strong><br />
„sozialistischen Gesetzlichkeit“, was aber <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> <strong>DDR</strong>, soweit bekannt, nicht als Problem<br />
angesehen wurde.<br />
Im Übrigen zeigt sich auch an <strong>der</strong> Interpretation<br />
des K<strong>in</strong>deswohlbegriffs nach 1952 die<br />
kollektivistische Ausrichtung auf staatliche<br />
Belange: In e<strong>in</strong>em Aufsatz aus dem Jahr<br />
1955 141 bekräftigt die Kreisreferent<strong>in</strong> für Jugendhilfe<br />
und <strong>Heimerziehung</strong> Schubert die<br />
<strong>in</strong> Kap. 2 bereits erwähnte Auffassung, dass<br />
<strong>in</strong> dem neuen sozialistischen Staatswesen<br />
nicht auf die alte, bürgerlich-kapitalistischen<br />
Zwecken dienende Auslegung des K<strong>in</strong>deswohlbegriffs<br />
zurückgegriffen werden könne.<br />
In Bezug auf das K<strong>in</strong>deswohl betont sie anschließend<br />
die Identität staatlicher und <strong>in</strong>dividueller<br />
(hier: <strong>der</strong> k<strong>in</strong>dlichen) Interessen. 142<br />
Das Wohl des K<strong>in</strong>des wird sodann zunächst<br />
unpolitisch konkretisiert durch die Merkmale<br />
„Sicherung aller Rechte des K<strong>in</strong>des“,<br />
„Schutz se<strong>in</strong>er Persönlichkeit“, „Durchsetzung<br />
se<strong>in</strong>es Rechts auf e<strong>in</strong>e gesunde<br />
Entwicklung“, „bestmögliche Entwicklung<br />
und Entfaltung aller se<strong>in</strong>er Anlagen“ sowie<br />
„Teilnahme am gesellschaftlichen Leben“. Die<br />
gesellschaftliche Vere<strong>in</strong>nahmung <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong><br />
und ihrer Familien wird erst <strong>in</strong> den weiteren<br />
Überlegungen deutlich: Die Jugendhilfe<br />
müsse sich beständig fragen, bei wem das<br />
K<strong>in</strong>d die besten Möglichkeiten fände, <strong>in</strong> die<br />
Gesellschaft h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>zuwachsen – wozu dann<br />
140 Vgl. dazu auch schon M<strong>in</strong>isterium für<br />
Volksbildung 1953, 39 (zu § 1666 BGB, § 63 RJWG:<br />
Herausnahme aus <strong>der</strong> Familie als letztes Mittel).<br />
141 Schubert 1955.<br />
142 Schubert 1955, 5: „In <strong>der</strong> Deutschen Demokratischen<br />
Republik ist das Wohl des K<strong>in</strong>des und das<br />
Wohl des Staates untrennbar verbunden.“<br />
40 41