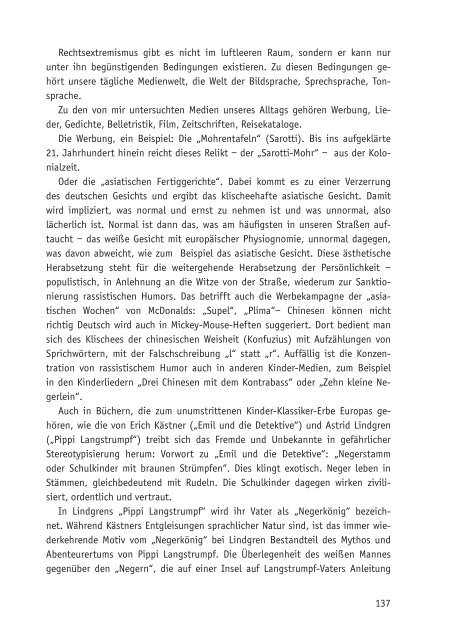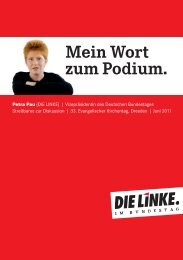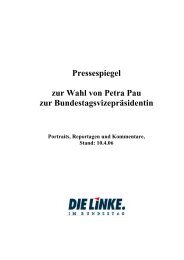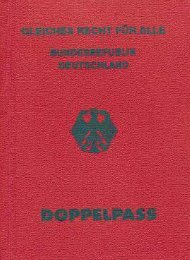download
download
download
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Rechtsextremismus gibt es nicht im luftleeren Raum, sondern er kann nur<br />
unter ihn begünstigenden Bedingungen existieren. Zu diesen Bedingungen gehört<br />
unsere tägliche Medienwelt, die Welt der Bildsprache, Sprechsprache, Tonsprache.<br />
Zu den von mir untersuchten Medien unseres Alltags gehören Werbung, Lieder,<br />
Gedichte, Belletristik, Film, Zeitschriften, Reisekataloge.<br />
Die Werbung, ein Beispiel: Die „Mohrentafeln“ (Sarotti). Bis ins aufgeklärte<br />
21. Jahrhundert hinein reicht dieses Relikt – der „Sarotti-Mohr“ – aus der Kolonialzeit.<br />
Oder die „asiatischen Fertiggerichte“. Dabei kommt es zu einer Verzerrung<br />
des deutschen Gesichts und ergibt das klischeehafte asiatische Gesicht. Damit<br />
wird impliziert, was normal und ernst zu nehmen ist und was unnormal, also<br />
lächerlich ist. Normal ist dann das, was am häufigsten in unseren Straßen auftaucht<br />
– das weiße Gesicht mit europäischer Physiognomie, unnormal dagegen,<br />
was davon abweicht, wie zum Beispiel das asiatische Gesicht. Diese ästhetische<br />
Herabsetzung steht für die weitergehende Herabsetzung der Persönlichkeit –<br />
populistisch, in Anlehnung an die Witze von der Straße, wiederum zur Sanktionierung<br />
rassistischen Humors. Das betrifft auch die Werbekampagne der „asiatischen<br />
Wochen“ von McDonalds: „Supel“, „Plima“– Chinesen können nicht<br />
richtig Deutsch wird auch in Mickey-Mouse-Heften suggeriert. Dort bedient man<br />
sich des Klischees der chinesischen Weisheit (Konfuzius) mit Aufzählungen von<br />
Sprichwörtern, mit der Falschschreibung „l“ statt „r“. Auffällig ist die Konzentration<br />
von rassistischem Humor auch in anderen Kinder-Medien, zum Beispiel<br />
in den Kinderliedern „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“ oder „Zehn kleine Negerlein“.<br />
Auch in Büchern, die zum unumstrittenen Kinder-Klassiker-Erbe Europas gehören,<br />
wie die von Erich Kästner („Emil und die Detektive“) und Astrid Lindgren<br />
(„Pippi Langstrumpf“) treibt sich das Fremde und Unbekannte in gefährlicher<br />
Stereotypisierung herum: Vorwort zu „Emil und die Detektive“: „Negerstamm<br />
oder Schulkinder mit braunen Strümpfen“. Dies klingt exotisch. Neger leben in<br />
Stämmen, gleichbedeutend mit Rudeln. Die Schulkinder dagegen wirken zivilisiert,<br />
ordentlich und vertraut.<br />
In Lindgrens „Pippi Langstrumpf“ wird ihr Vater als „Negerkönig“ bezeichnet.<br />
Während Kästners Entgleisungen sprachlicher Natur sind, ist das immer wiederkehrende<br />
Motiv vom „Negerkönig“ bei Lindgren Bestandteil des Mythos und<br />
Abenteurertums von Pippi Langstrumpf. Die Überlegenheit des weißen Mannes<br />
gegenüber den „Negern“, die auf einer Insel auf Langstrumpf-Vaters Anleitung<br />
137