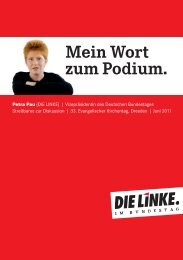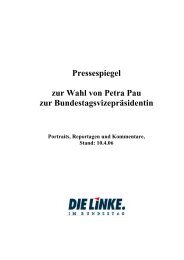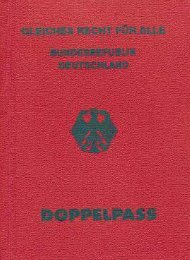download
download
download
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
liche Kulturpolitik nach realsozialistischen Reflexen auf der einen und durch<br />
neoliberale Tendenzen auf der anderen Seite beherrscht. Für die neoliberalen<br />
Tendenzen wirkt sich heute vor allem die Tatsache günstig aus, dass der bisherige<br />
Prozess der EU-Integration beinahe gänzlich dem Markt überlassen wurde.<br />
Ungarn wurde weitgehend zum Wirtschaftsfaktor degradiert. Als logische Konsequenz<br />
wird auch die EU-Integration als eine von oben herab geführte erneute<br />
„Kolonisation der Quote“ erlebt, weshalb die für sie dringend notwendige<br />
geistig-kulturelle Basis fehlt.<br />
Der Rassismus erwächst also aus dem Nationalismus, dem „Trost der Verlierer“,<br />
selbst wenn sie nicht de facto Verlierer sind, sondern sich im sozialpsychologischen<br />
Sinne nur so fühlen, etwa infolge von Identitätsverlust nach dem<br />
Auflösen der geschlossenen Gesellschaft der Kádár-Ära. Zum Erhalten der politischen<br />
Stabilität in Europa ist es also höchste Zeit für langfristig angelegte<br />
Investitionen in die kulturellen Identitäten einer künftigen zivilen Gesellschaft.<br />
Denn nur stabile Identitäten weichen den Fragen reflexiver Modernisierung nicht<br />
aus und halten Spannungen und Differenzen stand. Kultur darf wiederum nicht<br />
länger als Instrument des Machterhalts oder als das einer erhofften Gewinnmaximierung<br />
benutzt werden. Sie muss gegenüber Markt und Politik weitgehend<br />
autonom bleiben, denn nur eine autonome Kultur kann eine hohe Integrationsleistung<br />
hervorbringen und gesellschaftlich stabilisierend wirken.<br />
Tatjana Zhdanok, Vorsitzende der „Equal Rights“ Partei, Lettland<br />
Ich wurde gebeten, über die lettische Situation und die baltischen Staaten im<br />
Allgemeinen zu sprechen. Ich muss sagen, dass die Tendenzen und Entwicklungen<br />
in Lettland nach den Veränderungen 1989 und 1991 – besonders was Toleranz<br />
und Nichtdiskriminierung angeht – eher zerstörend sind. Besonders die<br />
Situation in Litauen und Estland ist hier bedenklich. Der Antisemitismus ist in<br />
Lettland weit verbreitet und ein Gewohnheitsphänomen. Die Gründe für dieses<br />
Phänomen, das ganz allgemein in allen osteuropäischen und besonders in postsowjetischen<br />
Ländern gilt, wurden bereits in unserem Workshop erwähnt. Ich<br />
werde mich daher auf einige spezifische Aspekte konzentrieren, die meiner Meinung<br />
nach grundlegend sind und für solche Trends positive Rahmenbedingungen<br />
schaffen.<br />
Zunächst einmal ist das der spezifische Status der drei baltischen Staaten, die<br />
1989/1991 aus den damaligen Entwicklungen hervorgegangen sind. Der zweite<br />
Grund ist der Ansatz der doppelten Standards westlicher Regierungen und in-<br />
160