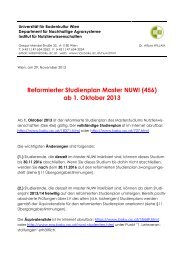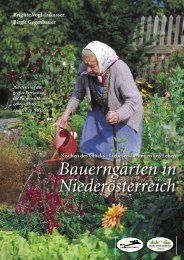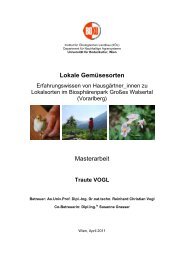Martina Grabowski - Institut für ökologischen Landbau - Boku
Martina Grabowski - Institut für ökologischen Landbau - Boku
Martina Grabowski - Institut für ökologischen Landbau - Boku
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die Ursprünge des Wissens über die Gesunderhaltung und Krankheitsbehandlung bei<br />
Tieren werden in zwei verschiedenen Bereichen vermutet. Zum einen behandeln sich die<br />
Tiere selbst, indem sie gewisse Pflanzen fressen oder sich auf gewisse Art und Weise<br />
verhalten. Verwundete Tiere wurden zum Beispiel beobachtet, wie sie sich in<br />
wirkstoffstoffreichem Moor gewälzt haben, worauf man dessen heilkräftige Wirkung<br />
erschlossen hat (Fink 2008:73). Diese Selbstbehandlung, in der Literatur<br />
„zoopharmacognosy“ (Pieroni et al 2004:74) beziehungsweise „autoveterinary medicine“<br />
(McCorkle et al 2001:4) genannt, stellt einen eigenen Forschungsbereich dar. Auf der<br />
anderen Seite besteht ein Naheverhältnis zur lokalen Volksmedizin <strong>für</strong> Menschen, und ein<br />
Teil der pflanzlichen Wirkstoffe wird sowohl <strong>für</strong> Menschen als auch <strong>für</strong> Tiere verwendet<br />
(Pieroni 2004:74).<br />
Als weitere Wissensquellen dienen die zahlreichen Schriften, die der Naturheilkunde, der<br />
Heilpflanzenkunde und der traditionellen Tierheilkunde gewidmet sind. Die frühesten<br />
Aufzeichnungen wurden in der babylonischen und sumerischen Keilschrift verfasst<br />
(Reichling et al. 2005:7). Insbesondere die Kräuterbücher und Rezeptsammlungen der<br />
Klöster stellen umfangreiche Quellen dar - als eine berühmte Stellvertreterin sei hier<br />
Hildegard von Bingen genannt. In Österreich sind zahlreiche historische Bücher zur<br />
Tierheilkunde, welche immer noch konsultiert werden, im Umlauf. Sie bieten uns heute<br />
wertvolle Einblicke in Wissensstand und Praktiken früherer Zeiten (Grasser 2006:11). In<br />
der grauen Literatur - Zeitungen, Magazine, Broschüren -, in den Medien, und<br />
insbesondere im Kontakt mit anderen Fachkundigen, Gästen und Bekannten, werden<br />
Wissensinhalte erworben und ausgetauscht (Grasser 2006:75f.).<br />
2.1.4 Lokales Erfahrungswissen im <strong>ökologischen</strong> <strong>Landbau</strong><br />
Seit dem Beginn der landwirtschaftlichen Nutzung vor fast 10.000 Jahren, war diese<br />
existentiell an indigenes Wissen über natürliche Ressourcen geknüpft (Osunade 1994:27).<br />
Die ökologische Landwirtschaft, wie sie heute praktiziert wird, hat sich aus dem lokalen<br />
Erfahrungswissen von Bäuerinnen und Bauern entwickelt. Der ganzheitliche Ansatz in der<br />
<strong>ökologischen</strong> Landwirtschaft spiegelt dieses Nahverhältnis wieder. Das bäuerliche<br />
Erfahrungswissen beschränkt sich nicht auf isolierte Fakten, sondern es ist in Werte,<br />
Einstellungen, Glaube, Sprache, soziale Beziehungen und Praktiken eingebettet und<br />
manifestiert (Vogl und Vogl-Lukasser 2006:3f.).<br />
In der gesetzlichen Regelung der EU <strong>für</strong> Bio-Tierhaltung, Verordnung 2092/91, wird der<br />
prophylaktische Gebrauch von Antibiotika und synthetischen Arzneimitteln generell<br />
verboten. Der Einsatz im Krankheitsfall ist stark reglementiert und limitiert; so sind zum<br />
Beispiel nach einer Antibiotikabehandlung doppelt so lange Wartezeiten wie in der<br />
konventionellen Tierhaltung vorgeschrieben. Wenn möglich sollen hingegen pflanzliche<br />
Arzneimittel präferiert werden, doch diese werden aus verschiedenen Gründen nur sehr<br />
wenig eingesetzt. Zum einen verfügen die Tierärztinnen und Tierärzte sowie die Bauern<br />
und Bäuerinnen nur mehr über begrenztes Wissen, weil vieles vergessen wurde. Außerdem<br />
ist die rechtliche Legitimierung des Einsatzes manchmal unklar. Vogl-Lukasser et al.<br />
haben herausgearbeitet, dass von Veterinärmedizinern und Veterinärmedizinerinnenin<br />
Österreich auch auf Bio-Betrieben, wo es gesetzlich nahegelegt wird, kaum mehr auf<br />
Pflanzenheilkunde zurück gegriffen wird (Vogl-Lukasser et al. 2006b:10f.).<br />
Die Bio-Tierhaltung hat sich mit den vier Basiselementen der Zucht, Fütterung,<br />
Tiergesundheit und der Haltung das Ziel gesetzt, ein möglichst hohes Gesundheitsniveau<br />
zu gewährleisten. Im Gegensatz zu den anderen Bereichen bestehen nach Zollitsch im<br />
Gesundheitsbereich keine klar ersichtlichen Vorteile, die sich aus dem System der<br />
15