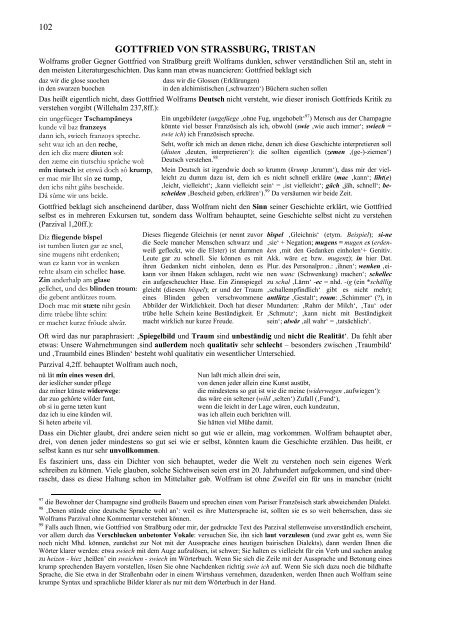Literaturgeschichte 750-1500
Literaturgeschichte 750-1500
Literaturgeschichte 750-1500
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
102<br />
GOTTFRIED VON STRASSBURG, TRISTAN<br />
Wolframs großer Gegner Gottfried von Straßburg greift Wolframs dunklen, schwer verständlichen Stil an, steht in<br />
den meisten <strong>Literaturgeschichte</strong>n. Das kann man etwas nuancieren: Gottfried beklagt sich<br />
daz wir die glose suochen<br />
dass wir die Glossen (Erklärungen)<br />
in den swarzen buochen<br />
in den alchimistischen (‚schwarzen‘) Büchern suchen sollen<br />
Das heißt eigentlich nicht, dass Gottfried Wolframs Deutsch nicht versteht, wie dieser ironisch Gottfrieds Kritik zu<br />
verstehen vorgibt (Willehalm 237,8ff.):<br />
ein ungefüeger Tschampâneys Ein ungebildeter (ungefüege ‚ohne Fug, ungehobelt‘ 97 ) Mensch aus der Champagne<br />
kunde vil baz franzeys<br />
könnte viel besser Französisch als ich, obwohl (swie ‚wie auch immer‘; swiech =<br />
dann ich, swiech franzoys spreche. swie ich) ich Französisch spreche.<br />
seht waz ich an den reche,<br />
den ich diz mære diuten sol:<br />
den zæme ein tiutschiu sprâche wol:<br />
mîn tiutsch ist etswâ doch sô krump,<br />
er mac mir lîht sîn ze tump,<br />
den ichs niht gâhs bescheide.<br />
Dâ sûme wir uns beide.<br />
Seht, wofür ich mich an denen räche, denen ich diese Geschichte interpretieren soll<br />
(diuten ‚deuten, interpretieren‘): die sollten eigentlich (zemen ‚(ge-)-ziemen‘)<br />
Deutsch verstehen. 98<br />
Mein Deutsch ist irgendwie doch so krumm (krump ‚krumm‘), dass mir der vielleicht<br />
zu dumm dazu ist, dem ich es nicht schnell erkläre (mac ‚kann‘; lîht(e)<br />
‚leicht, vielleicht‘; ‚kann vielleicht sein‘ = ‚ist vielleicht‘; gâch ‚jäh, schnell‘; bescheiden<br />
‚Bescheid geben, erklären‘). 99 Da versäumen wir beide Zeit.<br />
Gottfried beklagt sich anscheinend darüber, dass Wolfram nicht den Sinn seiner Geschichte erklärt, wie Gottfried<br />
selbst es in mehreren Exkursen tut, sondern dass Wolfram behauptet, seine Geschichte selbst nicht zu verstehen<br />
(Parzival 1,20ff.):<br />
Diz fliegende bîspel<br />
ist tumben liuten gar ze snel,<br />
sine mugens niht erdenken;<br />
wan ez kann vor in wenken<br />
rehte alsam ein schellec hase.<br />
Zin anderhalp am glase<br />
gelîchet, und des blinden troum:<br />
die gebent antlützes roum.<br />
Doch mac mit stæte niht gesîn<br />
dirre trüebe lîhte schîn:<br />
er machet kurze fröude alwâr.<br />
Dieses fliegende Gleichnis (er nennt zuvor<br />
die Seele mancher Menschen schwarz und<br />
weiß gefleckt, wie die Elster) ist dummen<br />
Leute gar zu schnell. Sie können es mit<br />
ihren Gedanken nicht einholen, denn es<br />
kann vor ihnen Haken schlagen, recht wie<br />
ein aufgescheuchter Hase. Ein Zinnspiegel<br />
gleicht (diesem bîspel); er und der Traum<br />
eines Blinden geben verschwommene<br />
Abbilder der Wirklichkeit. Doch hat dieser<br />
trübe helle Schein keine Beständigkeit. Er<br />
macht wirklich nur kurze Freude.<br />
bîspel ‚Gleichnis‘ (etym. Beispiel); si-ne<br />
‚sie‘ + Negation; mugens = mugen es (erdenken<br />
‚mit den Gedanken einholen‘+ Genitiv.<br />
Akk. wäre ez bzw. mugenz); in hier Dat.<br />
Plur. des Personalpron.: ‚ihnen‘; wenken ‚einen<br />
wanc (Schwenkung) machen‘; schellec<br />
zu schal ‚Lärm‘ -ec = nhd. -ig (ein *schällig<br />
‚schallempfindlich‘ gibt es nicht mehr);<br />
antlütze ‚Gestalt‘; roum: ‚Schimmer‘ (?), in<br />
Mundarten: ‚Rahm der Milch‘, ‚Tau‘ oder<br />
‚Schmutz‘; ‚kann nicht mit Beständigkeit<br />
sein‘; alwâr ‚all wahr‘ = ‚tatsächlich‘.<br />
Oft wird das nur paraphrasiert: ‚Spiegelbild und Traum sind unbeständig und nicht die Realität‘. Da fehlt aber<br />
etwas: Unsere Wahrnehmungen sind außerdem noch qualitativ sehr schlecht – besonders zwischen ‚Traumbild‘<br />
und ‚Traumbild eines Blinden‘ besteht wohl qualitativ ein wesentlicher Unterschied.<br />
Parzival 4,2ff. behauptet Wolfram auch noch,<br />
nû lât mîn eines wesen drî,<br />
Nun laßt mich allein drei sein,<br />
der ieslîcher sunder pflege<br />
von denen jeder allein eine Kunst ausübt,<br />
daz mîner künste widerwege:<br />
die mindestens so gut ist wie die meine (widerwegen ‚aufwiegen‘):<br />
dar zuo gehôrte wilder funt,<br />
das wäre ein seltener (wild ‚selten‘) Zufall (‚Fund‘),<br />
ob si iu gerne tæten kunt<br />
wenn die leicht in der Lage wären, euch kundzutun,<br />
daz ich iu eine künden wil.<br />
was ich allein euch berichten will.<br />
Si heten arbeite vil.<br />
Sie hätten viel Mühe damit.<br />
Dass ein Dichter glaubt, drei andere seien nicht so gut wie er allein, mag vorkommen. Wolfram behauptet aber,<br />
drei, von denen jeder mindestens so gut sei wie er selbst, könnten kaum die Geschichte erzählen. Das heißt, er<br />
selbst kann es nur sehr unvollkommen.<br />
Es fasziniert uns, dass ein Dichter von sich behauptet, weder die Welt zu verstehen noch sein eigenes Werk<br />
schreiben zu können. Viele glauben, solche Sichtweisen seien erst im 20. Jahrhundert aufgekommen, und sind überrascht,<br />
dass es diese Haltung schon im Mittelalter gab. Wolfram ist ohne Zweifel ein für uns in mancher (nicht<br />
97 die Bewohner der Champagne sind großteils Bauern und sprechen einen vom Pariser Französisch stark abweichenden Dialekt.<br />
98 ‚Denen stünde eine deutsche Sprache wohl an’: weil es ihre Muttersprache ist, sollten sie es so weit beherrschen, dass sie<br />
Wolframs Parzival ohne Kommentar verstehen können.<br />
99 Falls auch Ihnen, wie Gottfried von Straßburg oder mir, der gedruckte Text des Parzival stellenweise unverständlich erscheint,<br />
vor allem durch das Verschlucken unbetonter Vokale: versuchen Sie, ihn sich laut vorzulesen (und zwar geht es, wenn Sie<br />
noch nicht Mhd. können, zunächst zur Not mit der Aussprache eines heutigen bairischen Dialekts), dann werden Ihnen die<br />
Wörter klarer werden: etwa swiech mit dem Auge aufzulösen, ist schwer; Sie halten es vielleicht für ein Verb und suchen analog<br />
zu heizen - hiez ‚heißen’ ein sweichen - swiech im Wörterbuch. Wenn Sie sich die Zeile mit der Aussprache und Betonung eines<br />
krump sprechenden Bayern vorstellen, lösen Sie ohne Nachdenken richtig swie ich auf. Wenn Sie sich dazu noch die bildhafte<br />
Sprache, die Sie etwa in der Straßenbahn oder in einem Wirtshaus vernehmen, dazudenken, werden Ihnen auch Wolfram seine<br />
krumpe Syntax und sprachliche Bilder klarer als nur mit dem Wörterbuch in der Hand.