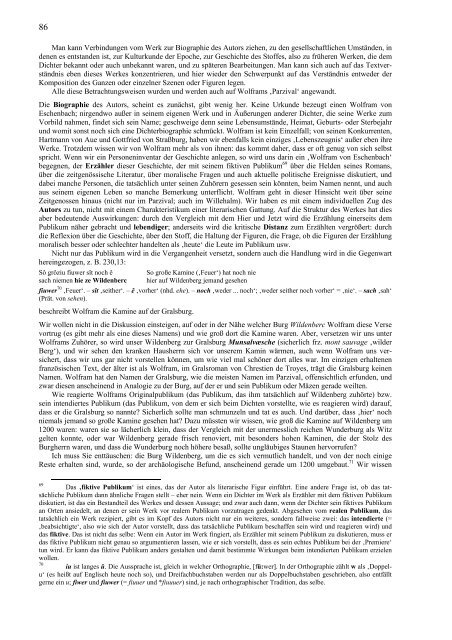Literaturgeschichte 750-1500
Literaturgeschichte 750-1500
Literaturgeschichte 750-1500
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
86<br />
Man kann Verbindungen vom Werk zur Biographie des Autors ziehen, zu den gesellschaftlichen Umständen, in<br />
denen es entstanden ist, zur Kulturkunde der Epoche, zur Geschichte des Stoffes, also zu früheren Werken, die dem<br />
Dichter bekannt oder auch unbekannt waren, und zu späteren Bearbeitungen. Man kann sich auch auf das Textverständnis<br />
eben dieses Werkes konzentrieren, und hier wieder den Schwerpunkt auf das Verständnis entweder der<br />
Komposition des Ganzen oder einzelner Szenen oder Figuren legen.<br />
Alle diese Betrachtungsweisen wurden und werden auch auf Wolframs ‚Parzival‘ angewandt.<br />
Die Biographie des Autors, scheint es zunächst, gibt wenig her. Keine Urkunde bezeugt einen Wolfram von<br />
Eschenbach; nirgendwo außer in seinem eigenen Werk und in Äußerungen anderer Dichter, die seine Werke zum<br />
Vorbild nahmen, findet sich sein Name; geschweige denn seine Lebensumstände, Heimat, Geburts- oder Sterbejahr<br />
und womit sonst noch sich eine Dichterbiographie schmückt. Wolfram ist kein Einzelfall; von seinen Konkurrenten,<br />
Hartmann von Aue und Gottfried von Straßburg, haben wir ebenfalls kein einziges ‚Lebenszeugnis‘ außer eben ihre<br />
Werke. Trotzdem wissen wir von Wolfram mehr als von ihnen: das kommt daher, dass er oft genug von sich selbst<br />
spricht. Wenn wir ein Personeninventar der Geschichte anlegen, so wird uns darin ein ‚Wolfram von Eschenbach‘<br />
begegnen, der Erzähler dieser Geschichte, der mit seinem fiktiven Publikum 69 über die Helden seines Romans,<br />
über die zeitgenössische Literatur, über moralische Fragen und auch aktuelle politische Ereignisse diskutiert, und<br />
dabei manche Personen, die tatsächlich unter seinen Zuhörern gesessen sein könnten, beim Namen nennt, und auch<br />
aus seinem eigenen Leben so manche Bemerkung unterflicht. Wolfram geht in dieser Hinsicht weit über seine<br />
Zeitgenossen hinaus (nicht nur im Parzival; auch im Willehalm). Wir haben es mit einem individuellen Zug des<br />
Autors zu tun, nicht mit einem Charakteristikum einer literarischen Gattung. Auf die Struktur des Werkes hat dies<br />
aber bedeutende Auswirkungen: durch den Vergleich mit dem Hier und Jetzt wird die Erzählung einerseits dem<br />
Publikum näher gebracht und lebendiger; anderseits wird die kritische Distanz zum Erzählten vergrößert: durch<br />
die Reflexion über die Geschichte, über den Stoff, die Haltung der Figuren, die Frage, ob die Figuren der Erzählung<br />
moralisch besser oder schlechter handelten als ‚heute‘ die Leute im Publikum usw.<br />
Nicht nur das Publikum wird in die Vergangenheit versetzt, sondern auch die Handlung wird in die Gegenwart<br />
hereingezogen, z. B. 230,13:<br />
Sô grôziu fiuwer sît noch ê So große Kamine (‚Feuer‘) hat noch nie<br />
sach niemen hie ze Wildenberc hier auf Wildenberg jemand gesehen<br />
fiuwer 70 ‚Feuer‘. – sît ‚seither‘. – ê ‚vorher‘ (nhd. ehe). – noch ‚weder ... noch‘; ‚weder seither noch vorher‘ = ‚nie‘. – sach ‚sah‘<br />
(Prät. von sehen).<br />
beschreibt Wolfram die Kamine auf der Gralsburg.<br />
Wir wollen nicht in die Diskussion einsteigen, auf oder in der Nähe welcher Burg Wildenberc Wolfram diese Verse<br />
vortrug (es gibt mehr als eine dieses Namens) und wie groß dort die Kamine waren. Aber, versetzen wir uns unter<br />
Wolframs Zuhörer, so wird unser Wildenberg zur Gralsburg Munsalvæsche (sicherlich frz. mont sauvage ‚wilder<br />
Berg‘), und wir sehen den kranken Hausherrn sich vor unserem Kamin wärmen, auch wenn Wolfram uns versichert,<br />
dass wir uns gar nicht vorstellen können, um wie viel mal schöner dort alles war. Im einzigen erhaltenen<br />
französischen Text, der älter ist als Wolfram, im Gralsroman von Chrestien de Troyes, trägt die Gralsburg keinen<br />
Namen. Wolfram hat den Namen der Gralsburg, wie die meisten Namen im Parzival, offensichtlich erfunden, und<br />
zwar diesen anscheinend in Analogie zu der Burg, auf der er und sein Publikum oder Mäzen gerade weilten.<br />
Wie reagierte Wolframs Originalpublikum (das Publikum, das ihm tatsächlich auf Wildenberg zuhörte) bzw.<br />
sein intendiertes Publikum (das Publikum, von dem er sich beim Dichten vorstellte, wie es reagieren wird) darauf,<br />
dass er die Gralsburg so nannte? Sicherlich sollte man schmunzeln und tat es auch. Und darüber, dass ‚hier‘ noch<br />
niemals jemand so große Kamine gesehen hat? Dazu müssten wir wissen, wie groß die Kamine auf Wildenberg um<br />
1200 waren: waren sie so lächerlich klein, dass der Vergleich mit der unermesslich reichen Wunderburg als Witz<br />
gelten konnte, oder war Wildenberg gerade frisch renoviert, mit besonders hohen Kaminen, die der Stolz des<br />
Burgherrn waren, und dass die Wunderburg noch höhere besaß, sollte ungläubiges Staunen hervorrufen?<br />
Ich muss Sie enttäuschen: die Burg Wildenberg, um die es sich vermutlich handelt, und von der noch einige<br />
Reste erhalten sind, wurde, so der archäologische Befund, anscheinend gerade um 1200 umgebaut. 71 Wir wissen<br />
69<br />
Das ‚fiktive Publikum‘ ist eines, das der Autor als literarische Figur einführt. Eine andere Frage ist, ob das tatsächliche<br />
Publikum dann ähnliche Fragen stellt – eher nein. Wenn ein Dichter im Werk als Erzähler mit dem fiktiven Publikum<br />
diskutiert, ist das ein Bestandteil des Werkes und dessen Aussage; und zwar auch dann, wenn der Dichter sein fiktives Publikum<br />
an Orten ansiedelt, an denen er sein Werk vor realem Publikum vorzutragen gedenkt. Abgesehen vom realen Publikum, das<br />
tatsächlich ein Werk rezipiert, gibt es im Kopf des Autors nicht nur ein weiteres, sondern fallweise zwei: das intendierte (=<br />
‚beabsichtigte‘, also wie sich der Autor vorstellt, dass das tatsächliche Publikum beschaffen sein wird und reagieren wird) und<br />
das fiktive. Das ist nicht das selbe: Wenn ein Autor im Werk fingiert, als Erzähler mit seinem Publikum zu diskutieren, muss er<br />
das fiktive Publikum nicht genau so argumentieren lassen, wie er sich vorstellt, dass es sein echtes Publikum bei der ‚Premiere‘<br />
tun wird. Er kann das fiktive Publikum anders gestalten und damit bestimmte Wirkungen beim intendierten Publikum erzielen<br />
wollen.<br />
70<br />
iu ist langes ü. Die Aussprache ist, gleich in welcher Orthographie, [fü:wer]. In der Orthographie zählt w als ‚Doppelu‘<br />
(es heißt auf Englisch heute noch so), und Dreifachbuchstaben werden nur als Doppelbuchstaben geschrieben, also entfällt<br />
gerne ein u; fiwer und fiuwer (= fiuuer und *fiuuuer) sind, je nach orthographischer Tradition, das selbe.