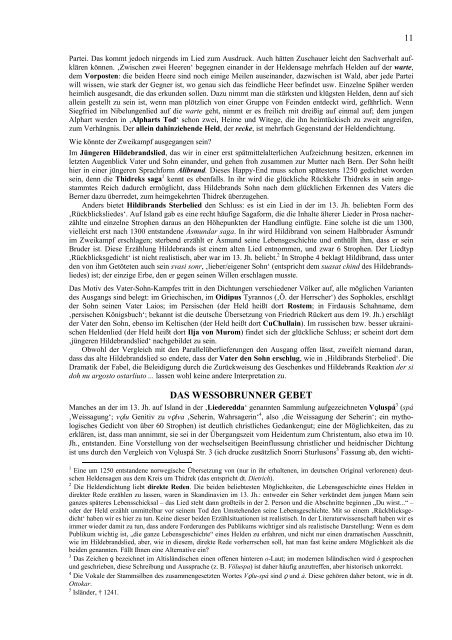Literaturgeschichte 750-1500
Literaturgeschichte 750-1500
Literaturgeschichte 750-1500
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Partei. Das kommt jedoch nirgends im Lied zum Ausdruck. Auch hätten Zuschauer leicht den Sachverhalt aufklären<br />
können. ‚Zwischen zwei Heeren‘ begegnen einander in der Heldensage mehrfach Helden auf der warte,<br />
dem Vorposten: die beiden Heere sind noch einige Meilen auseinander, dazwischen ist Wald, aber jede Partei<br />
will wissen, wie stark der Gegner ist, wo genau sich das feindliche Heer befindet usw. Einzelne Späher werden<br />
heimlich ausgesandt, die das erkunden sollen. Dazu nimmt man die stärksten und klügsten Helden, denn auf sich<br />
allein gestellt zu sein ist, wenn man plötzlich von einer Gruppe von Feinden entdeckt wird, gefährlich. Wenn<br />
Siegfried im Nibelungenlied auf die warte geht, nimmt er es freilich mit dreißig auf einmal auf; dem jungen<br />
Alphart werden in ‚Alpharts Tod‘ schon zwei, Heime und Witege, die ihn heimtückisch zu zweit angreifen,<br />
zum Verhängnis. Der allein dahinziehende Held, der recke, ist mehrfach Gegenstand der Heldendichtung.<br />
Wie könnte der Zweikampf ausgegangen sein?<br />
Im Jüngeren Hildebrandslied, das wir in einer erst spätmittelalterlichen Aufzeichnung besitzen, erkennen im<br />
letzten Augenblick Vater und Sohn einander, und gehen froh zusammen zur Mutter nach Bern. Der Sohn heißt<br />
hier in einer jüngeren Sprachform Alibrand. Dieses Happy-End muss schon spätestens 1250 gedichtet worden<br />
sein, denn die Thidreks saga 1 kennt es ebenfalls. In ihr wird die glückliche Rückkehr Thidreks in sein angestammtes<br />
Reich dadurch ermöglicht, dass Hildebrands Sohn nach dem glücklichen Erkennen des Vaters die<br />
Berner dazu überredet, zum heimgekehrten Thidrek überzugehen.<br />
Anders bietet Hildibrands Sterbelied den Schluss: es ist ein Lied in der im 13. Jh. beliebten Form des<br />
‚Rückblicksliedes‘. Auf Island gab es eine recht häufige Sagaform, die die Inhalte älterer Lieder in Prosa nacherzählte<br />
und einzelne Strophen daraus an den Höhepunkten der Handlung einfügte. Eine solche ist die um 1300,<br />
vielleicht erst nach 1300 entstandene Ásmundar saga. In ihr wird Hildibrand von seinem Halbbruder Ásmundr<br />
im Zweikampf erschlagen; sterbend erzählt er Ásmund seine Lebensgeschichte und enthüllt ihm, dass er sein<br />
Bruder ist. Diese Erzählung Hildebrands ist einem alten Lied entnommen, und zwar 6 Strophen. Der Liedtyp<br />
‚Rückblicksgedicht‘ ist nicht realistisch, aber war im 13. Jh. beliebt. 2 In Strophe 4 beklagt Hildibrand, dass unter<br />
den von ihm Getöteten auch sein svasi sonr, ‚lieber/eigener Sohn‘ (entspricht dem suasat chind des Hildebrandsliedes)<br />
ist; der einzige Erbe, den er gegen seinen Willen erschlagen musste.<br />
Das Motiv des Vater-Sohn-Kampfes tritt in den Dichtungen verschiedener Völker auf, alle möglichen Varianten<br />
des Ausgangs sind belegt: im Griechischen, im Oidipus Tyrannos (‚Ö. der Herrscher‘) des Sophokles, erschlägt<br />
der Sohn seinen Vater Laios; im Persischen (der Held heißt dort Rostem; in Firdausis Schahname, dem<br />
‚persischen Königsbuch‘; bekannt ist die deutsche Übersetzung von Friedrich Rückert aus dem 19. Jh.) erschlägt<br />
der Vater den Sohn, ebenso im Keltischen (der Held heißt dort CuChullain). Im russischen bzw. besser ukrainischen<br />
Heldenlied (der Held heißt dort Ilja von Murom) findet sich der glückliche Schluss; er scheint dort dem<br />
‚jüngeren Hildebrandslied‘ nachgebildet zu sein.<br />
Obwohl der Vergleich mit den Parallelüberlieferungen den Ausgang offen lässt, zweifelt niemand daran,<br />
dass das alte Hildebrandslied so endete, dass der Vater den Sohn erschlug, wie in ‚Hildibrands Sterbelied‘. Die<br />
Dramatik der Fabel, die Beleidigung durch die Zurückweisung des Geschenkes und Hildebrands Reaktion der si<br />
doh nu argosto ostarliuto ... lassen wohl keine andere Interpretation zu.<br />
DAS WESSOBRUNNER GEBET<br />
Manches an der im 13. Jh. auf Island in der ‚Liederedda‘ genannten Sammlung aufgezeichneten V÷luspá 3 (spá<br />
‚Weissagung‘; v÷lu Genitiv zu võlva ‚Seherin, Wahrsagerin‘ 4 , also ‚die Weissagung der Seherin‘; ein mythologisches<br />
Gedicht von über 60 Strophen) ist deutlich christliches Gedankengut; eine der Möglichkeiten, das zu<br />
erklären, ist, dass man annimmt, sie sei in der Übergangszeit vom Heidentum zum Christentum, also etwa im 10.<br />
Jh., entstanden. Eine Vorstellung von der wechselseitigen Beeinflussung christlicher und heidnischer Dichtung<br />
ist uns durch den Vergleich von V÷luspá Str. 3 (ich drucke zusätzlich Snorri Sturlusons 5 Fassung ab, den wichti-<br />
1 Eine um 1250 entstandene norwegische Übersetzung von (nur in ihr erhaltenen, im deutschen Original verlorenen) deutschen<br />
Heldensagen aus dem Kreis um Thidrek (das entspricht dt. Dietrich).<br />
2 Die Heldendichtung liebt direkte Reden. Die beiden beliebtesten Möglichkeiten, die Lebensgeschichte eines Helden in<br />
direkter Rede erzählen zu lassen, waren in Skandinavien im 13. Jh.: entweder ein Seher verkündet dem jungen Mann sein<br />
ganzes späteres Lebensschicksal – das Lied steht dann großteils in der 2. Person und die Abschnitte beginnen „Du wirst...“ –<br />
oder der Held erzählt unmittelbar vor seinem Tod den Umstehenden seine Lebensgeschichte. Mit so einem ‚Rückblicksgedicht‘<br />
haben wir es hier zu tun. Keine dieser beiden Erzählsituationen ist realistisch. In der Literaturwissenschaft haben wir es<br />
immer wieder damit zu tun, dass andere Forderungen des Publikums wichtiger sind als realistische Darstellung: Wenn es dem<br />
Publikum wichtig ist, „die ganze Lebensgeschichte“ eines Helden zu erfahren, und nicht nur einen dramatischen Ausschnitt,<br />
wie im Hildebrandslied, aber, wie in diesem, direkte Rede vorherrschen soll, hat man fast keine andere Möglichkeit als die<br />
beiden genannten. Fällt Ihnen eine Alternative ein?<br />
3 Das Zeichen ÷ bezeichnet im Altisländischen einen offenen hinteren o-Laut; im modernen Isländischen wird ö gesprochen<br />
und geschrieben, diese Schreibung und Aussprache (z. B. Völuspa) ist daher häufig anzutreffen, aber historisch unkorrekt.<br />
4 Die Vokale der Stammsilben des zusammengesetzten Wortes Võlu-spá sind õ und á. Diese gehören daher betont, wie in dt.<br />
Ottokar.<br />
5 Isländer, † 1241.<br />
11