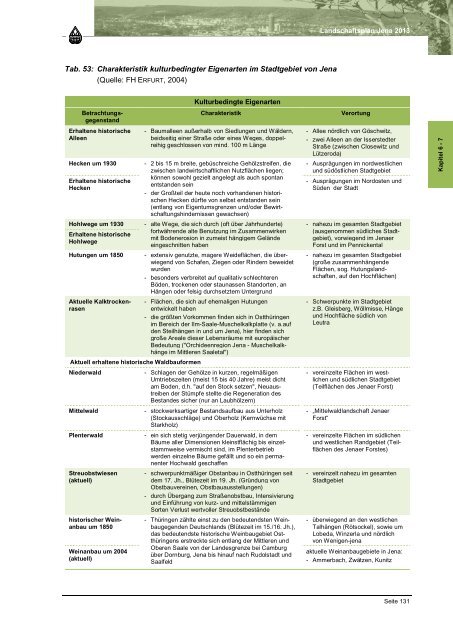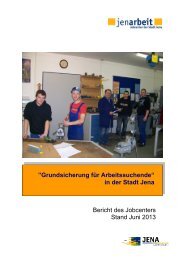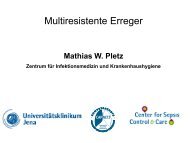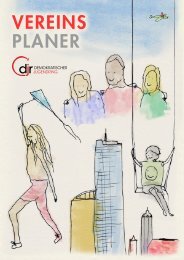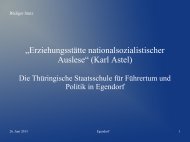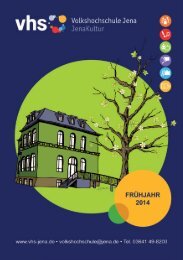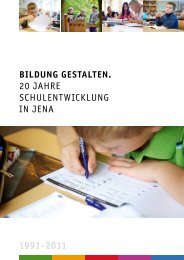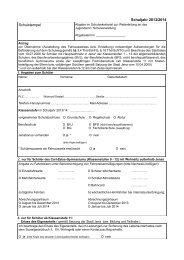Entwurf Landschaftsplan 2013, Text (application/pdf 9.9 MB) - Jena
Entwurf Landschaftsplan 2013, Text (application/pdf 9.9 MB) - Jena
Entwurf Landschaftsplan 2013, Text (application/pdf 9.9 MB) - Jena
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Jena</strong> <strong>2013</strong><br />
Tab. 53: Charakteristik kulturbedingter Eigenarten im Stadtgebiet von <strong>Jena</strong><br />
(Quelle: FH ERFURT, 2004)<br />
Betrachtungsgegenstand<br />
Erhaltene historische<br />
Alleen<br />
Hecken um 1930<br />
Erhaltene historische<br />
Hecken<br />
Hohlwege um 1930<br />
Erhaltene historische<br />
Hohlwege<br />
Hutungen um 1850<br />
Aktuelle Kalktrockenrasen<br />
Aktuell erhaltene historische Waldbauformen<br />
Niederwald<br />
Mittelwald<br />
Plenterwald<br />
Streuobstwiesen<br />
(aktuell)<br />
historischer Weinanbau<br />
um 1850<br />
Weinanbau um 2004<br />
(aktuell)<br />
Kulturbedingte Eigenarten<br />
Charakteristik<br />
- Baumalleen außerhalb von Siedlungen und Wäldern,<br />
beidseitig einer Straße oder eines Weges, doppelreihig<br />
geschlossen von mind. 100 m Länge<br />
- 2 bis 15 m breite, gebüschreiche Gehölzstreifen, die<br />
zwischen landwirtschaftlichen Nutzflächen liegen;<br />
können sowohl gezielt angelegt als auch spontan<br />
entstanden sein<br />
- der Großteil der heute noch vorhandenen historischen<br />
Hecken dürfte von selbst entstanden sein<br />
(entlang von Eigentumsgrenzen und/oder Bewirtschaftungshindernissen<br />
gewachsen)<br />
- alte Wege, die sich durch (oft über Jahrhunderte)<br />
fortwährende alte Benutzung im Zusammenwirken<br />
mit Bodenerosion in zumeist hängigem Gelände<br />
eingeschnitten haben<br />
- extensiv genutzte, magere Weideflächen, die überwiegend<br />
von Schafen, Ziegen oder Rindern beweidet<br />
wurden<br />
- besonders verbreitet auf qualitativ schlechteren<br />
Böden, trockenen oder staunassen Standorten, an<br />
Hängen oder felsig durchsetztem Untergrund<br />
- Flächen, die sich auf ehemaligen Hutungen<br />
entwickelt haben<br />
- die größten Vorkommen finden sich in Ostthüringen<br />
im Bereich der Ilm-Saale-Muschelkalkplatte (v. a.auf<br />
den Steilhängen in und um <strong>Jena</strong>), hier finden sich<br />
große Areale dieser Lebensräume mit europäischer<br />
Bedeutung ("Orchideenregion <strong>Jena</strong> - Muschelkalkhänge<br />
im Mittleren Saaletal")<br />
- Schlagen der Gehölze in kurzen, regelmäßigen<br />
Umtriebszeiten (meist 15 bis 40 Jahre) meist dicht<br />
am Boden, d.h. "auf den Stock setzen", Neuaustreiben<br />
der Stümpfe stellte die Regeneration des<br />
Bestandes sicher (nur an Laubhölzern)<br />
- stockwerksartiger Bestandsaufbau aus Unterholz<br />
(Stockausschläge) und Oberholz (Kernwüchse mit<br />
Starkholz)<br />
- ein sich stetig verjüngender Dauerwald, in dem<br />
Bäume aller Dimensionen kleinstflächig bis einzelstammweise<br />
vermischt sind, im Plenterbetrieb<br />
werden einzelne Bäume gefällt und so ein permanenter<br />
Hochwald geschaffen<br />
- schwerpunktmäßiger Obstanbau in Ostthüringen seit<br />
dem 17. Jh., Blütezeit im 19. Jh. (Gründung von<br />
Obstbauvereinen, Obstbauausstellungen)<br />
- durch Übergang zum Straßenobstbau, Intensivierung<br />
und Einführung von kurz- und mittelstämmigen<br />
Sorten Verlust wertvoller Streuobstbestände<br />
- Thüringen zählte einst zu den bedeutendsten Weinbaugegenden<br />
Deutschlands (Blütezeit im 15./16. Jh.),<br />
das bedeutendste historische Weinbaugebiet Ostthüringens<br />
erstreckte sich entlang der Mittleren und<br />
Oberen Saale von der Landesgrenze bei Camburg<br />
über Dornburg, <strong>Jena</strong> bis hinauf nach Rudolstadt und<br />
Saalfeld<br />
Verortung<br />
- Allee nördlich von Göschwitz,<br />
- zwei Alleen an der Isserstedter<br />
Straße (zwischen Closewitz und<br />
Lützeroda)<br />
- Ausprägungen im nordwestlichen<br />
und südöstlichen Stadtgebiet<br />
- Ausprägungen im Nordosten und<br />
Süden der Stadt<br />
- nahezu im gesamten Stadtgebiet<br />
(ausgenommen südliches Stadtgebiet),<br />
vorwiegend im <strong>Jena</strong>er<br />
Forst und im Pennickental<br />
- nahezu im gesamten Stadtgebiet<br />
(große zusammenhängende<br />
Flächen, sog. Hutungslandschaften,<br />
auf den Hochflächen)<br />
- Schwerpunkte im Stadtgebiet<br />
z.B. Gleisberg, Wöllmisse, Hänge<br />
und Hochfläche südlich von<br />
Leutra<br />
- vereinzelte Flächen im westlichen<br />
und südlichen Stadtgebiet<br />
(Teilflächen des <strong>Jena</strong>er Forst)<br />
- „Mittelwaldlandschaft <strong>Jena</strong>er<br />
Forst“<br />
- vereinzelte Flächen im südlichen<br />
und westlichen Randgebiet (Teilflächen<br />
des <strong>Jena</strong>er Forstes)<br />
- vereinzelt nahezu im gesamten<br />
Stadtgebiet<br />
- überwiegend an den westlichen<br />
Talhängen (Rötsockel), sowie um<br />
Lobeda, Winzerla und nördlich<br />
von Wenigen-jena<br />
aktuelle Weinanbaugebiete in <strong>Jena</strong>:<br />
- Ammerbach, Zwätzen, Kunitz<br />
Kapitel 6 - 7<br />
Seite 131