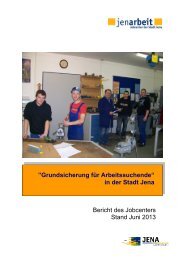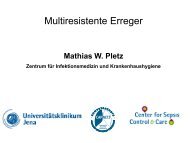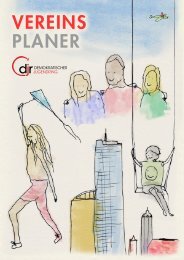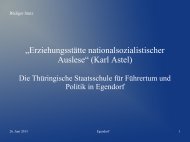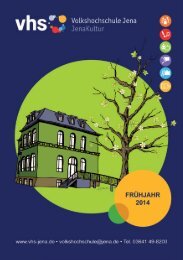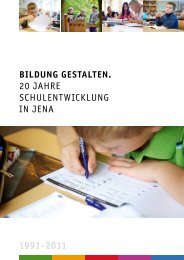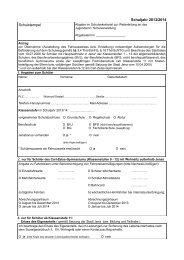Entwurf Landschaftsplan 2013, Text (application/pdf 9.9 MB) - Jena
Entwurf Landschaftsplan 2013, Text (application/pdf 9.9 MB) - Jena
Entwurf Landschaftsplan 2013, Text (application/pdf 9.9 MB) - Jena
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Jena</strong> <strong>2013</strong><br />
6.3 Siedlungs- und Landschaftsgeschichte<br />
Siedlungsentwicklung<br />
Der Landschaftsraum der Mittleren Saale war bereits vor etwa 12.000 Jahren während einer Warmphase<br />
der letzten Eiszeit erstmals besiedelt, wie die Ausgrabung einer Siedlung von Wildpferdjägern<br />
am Helenenstein östlich von Maua belegt. Neben fruchtbarem Boden und ausreichendem Wasservorkommen<br />
war vor allem eine geschützte Lage meteorologisch und strategisch für eine Siedlungsgründung<br />
von Bedeutung. Überschwemmungsgebiete, wie die Saaleaue wurden dabei generell gemieden.<br />
Um 10.000 v. Chr. zogen Jäger und Sammler von Süden an den Flussläufen von Saale und Orla entlang<br />
und stießen in das Thüringer Becken vor.<br />
Kapitel 6 - 7<br />
Im Verlauf des 1. Jahrhunderts n. Chr. drangen Warnen und Angeln aus nördlichen Regionen in das<br />
Gebiet vor. Im 4. Jahrhundert gründeten die Thüringer ein Königreich, das jedoch schon im<br />
6. Jahrhundert von den Franken erobert wurde. In den folgenden Jahrhunderten erreichten Slawen<br />
aus dem Böhmischen Raum in mehreren Schüben das Mittlere Saaletal und besiedelten vor allem die<br />
Gebiete östlich des Flusslaufes. Die westlichen Seitentäler und Hochebenen wurden hingegen von<br />
Germanen besiedelt. Die Saale bildete eine natürliche Grenze zwischen beiden Volksstämmen, die<br />
sich erst im 9. und 10. Jahrhundert durchmischten. Thüringische Siedler drangen über die Saale nach<br />
Osten, rodeten den Wald und legten neue Siedlungen an. Auf slawische Herkunft lassen heute noch<br />
Ortsnamen auf „-itz“, „-witz“ und „-nitz“ (z. B. Oßmaritz, Göschwitz, Wöllnitz) schließen, während Endungen<br />
auf „-a“ und „-stedt“ eine germanische Gründung vermuten lassen (z. B. <strong>Jena</strong>, Winzerla,<br />
Leutra, Löbstedt). Namensendungen auf „-roda“ und „-hain“ weisen auf eine Ortsgründung an einer<br />
Rodungsstelle hin (Münchenroda, Remderoda, Lichtenhain). Das „rod", als Ausdruck für urbar gemachtes<br />
Waldland ist in Thüringen seit 800 n. Chr. belegt (nach: STOCK+PARTNER, 2003).<br />
Landschaftsentwicklung<br />
Vor Beginn der Rodungstätigkeit des Menschen war das Stadtgebiet von <strong>Jena</strong> weitgehend bewaldet.<br />
Ausnahmen bildeten die Felsen, die steilen Schuttfluren und die Flussaue der Saale. Artenreiche<br />
Kalk-Buchenwälder und Eichen-Hainbuchen-Wälder gehörten zur ursprünglichen natürlichen Vegetation.<br />
Mit Beginn der Besiedlung griff der Mensch in das Landschaftsgefüge ein, ohne es zunächst<br />
dauerhaft zu beeinflussen. Erst mit der Sesshaftwerdung (3.000 bis 2.000 v. Chr.) entstanden örtlich<br />
begrenzte Rodungen. Während der Bronzezeit (ca. 1.800 v. Chr.) erfolgten größere Rodungen und<br />
örtlich intensive Nutzungen. Dennoch war die Verteilung von Kulturland und Wald eine konstante Größe.<br />
Wüstungen und Neugründungen wechselten sich im Laufe der Jahrhunderte ab, so dass immer<br />
wieder Wald gerodet wurde und sich auf brach gefallenen Flächen neuer Bestand entwickelte.<br />
Großflächige Rodungen erfolgten jedoch erst im 7. Jahrhundert n. Chr. durch die Ausdehnung des<br />
Ackerbaus. Im Mittelalter war die Kulturlandschaft geprägt durch die Dreifelderwirtschaft, ausgedehnte<br />
Hutungsflächen, Nieder- und Mittelwaldwirtschaft sowie in wärmebegünstigten Lagen Wein- und Obstanbau.<br />
Der Weinanbau hatte seine größte Ausbreitung in <strong>Jena</strong> im 16. bis Mitte des 17. Jahrhunderts.<br />
Damals waren der Jenzig, die Sonnenberge, der Steiger und die Eule mit insgesamt 700 ha Rebfläche<br />
die größten Weinbergslagen. Danach ging der Weinanbau aufgrund der Konkurrenz mit Weinbaugebieten<br />
südlich der Alpen, Rebkrankheiten und Klimaveränderungen ständig zurück, bis er Anfang des<br />
20. Jahrhunderts fast völlig zum Erliegen kam. Die infolge des Weinbaus entstandenen kahlen Muschelkalkhänge<br />
prägen jedoch bis heute das unverwechselbare Landschaftsbild des Mittleren Saaletals.<br />
Im 18. Jahrhundert wurde wegen des gestiegenen Bedarfs mit der geregelten Holzwirtschaft be-<br />
Seite 70