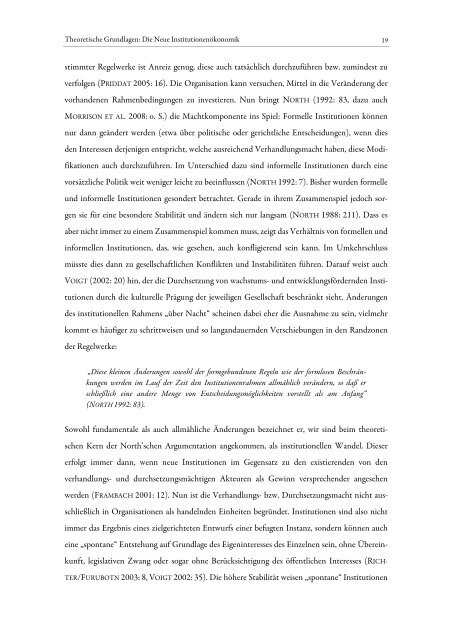Organisatorischer Zusammenschluss von Kleinunternehmen in der ...
Organisatorischer Zusammenschluss von Kleinunternehmen in der ...
Organisatorischer Zusammenschluss von Kleinunternehmen in der ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Theoretische Grundlagen: Die Neue Institutionenökonomik<br />
stimmter Regelwerke ist Anreiz genug, diese auch tatsächlich durchzuführen bzw. zum<strong>in</strong>dest zu<br />
verfolgen (PRIDDAT 2005: 16). Die Organisation kann versuchen, Mittel <strong>in</strong> die Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong><br />
vorhandenen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen zu <strong>in</strong>vestieren. Nun br<strong>in</strong>gt NORTH (1992: 83, dazu auch<br />
MORRISON ET AL. 2008: o. S.) die Machtkomponente <strong>in</strong>s Spiel: Formelle Institutionen können<br />
nur dann geän<strong>der</strong>t werden (etwa über politische o<strong>der</strong> gerichtliche Entscheidungen), wenn dies<br />
den Interessen <strong>der</strong>jenigen entspricht, welche ausreichend Verhandlungsmacht haben, diese Modi-<br />
fikationen auch durchzuführen. Im Unterschied dazu s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>formelle Institutionen durch e<strong>in</strong>e<br />
vorsätzliche Politik weit weniger leicht zu bee<strong>in</strong>flussen (NORTH 1992: 7). Bisher wurden formelle<br />
und <strong>in</strong>formelle Institutionen geson<strong>der</strong>t betrachtet. Gerade <strong>in</strong> ihrem Zusammenspiel jedoch sor-<br />
gen sie für e<strong>in</strong>e beson<strong>der</strong>e Stabilität und än<strong>der</strong>n sich nur langsam (NORTH 1988: 211). Dass es<br />
aber nicht immer zu e<strong>in</strong>em Zusammenspiel kommen muss, zeigt das Verhältnis <strong>von</strong> formellen und<br />
<strong>in</strong>formellen Institutionen, das, wie gesehen, auch konfligierend se<strong>in</strong> kann. Im Umkehrschluss<br />
müsste dies dann zu gesellschaftlichen Konflikten und Instabilitäten führen. Darauf weist auch<br />
VOIGT (2002: 20) h<strong>in</strong>, <strong>der</strong> die Durchsetzung <strong>von</strong> wachstums- und entwicklungsför<strong>der</strong>nden Insti-<br />
tutionen durch die kulturelle Prägung <strong>der</strong> jeweiligen Gesellschaft beschränkt sieht. Än<strong>der</strong>ungen<br />
des <strong>in</strong>stitutionellen Rahmens „über Nacht“ sche<strong>in</strong>en dabei eher die Ausnahme zu se<strong>in</strong>, vielmehr<br />
kommt es häufiger zu schrittweisen und so langandauernden Verschiebungen <strong>in</strong> den Randzonen<br />
<strong>der</strong> Regelwerke:<br />
„Diese kle<strong>in</strong>en Än<strong>der</strong>ungen sowohl <strong>der</strong> formgebundenen Regeln wie <strong>der</strong> formlosen Beschränkungen<br />
werden im Lauf <strong>der</strong> Zeit den Institutionenrahmen allmählich verän<strong>der</strong>n, so daß er<br />
schließlich e<strong>in</strong>e an<strong>der</strong>e Menge <strong>von</strong> Entscheidungsmöglichkeiten vorstellt als am Anfang“<br />
(NORTH 1992: 83).<br />
Sowohl fundamentale als auch allmähliche Än<strong>der</strong>ungen bezeichnet er, wir s<strong>in</strong>d beim theoreti-<br />
schen Kern <strong>der</strong> North’schen Argumentation angekommen, als <strong>in</strong>stitutionellen Wandel. Dieser<br />
erfolgt immer dann, wenn neue Institutionen im Gegensatz zu den existierenden <strong>von</strong> den<br />
verhandlungs- und durchsetzungsmächtigen Akteuren als Gew<strong>in</strong>n versprechen<strong>der</strong> angesehen<br />
werden (FRAMBACH 2001: 12). Nun ist die Verhandlungs- bzw. Durchsetzungsmacht nicht aus-<br />
schließlich <strong>in</strong> Organisationen als handelnden E<strong>in</strong>heiten begründet. Institutionen s<strong>in</strong>d also nicht<br />
immer das Ergebnis e<strong>in</strong>es zielgerichteten Entwurfs e<strong>in</strong>er befugten Instanz, son<strong>der</strong>n können auch<br />
e<strong>in</strong>e „spontane“ Entstehung auf Grundlage des Eigen<strong>in</strong>teresses des E<strong>in</strong>zelnen se<strong>in</strong>, ohne Übere<strong>in</strong>-<br />
kunft, legislativen Zwang o<strong>der</strong> sogar ohne Berücksichtigung des öffentlichen Interesses (RICH-<br />
TER/FURUBOTN 2003: 8, VOIGT 2002: 35). Die höhere Stabilität weisen „spontane“ Institutionen<br />
19