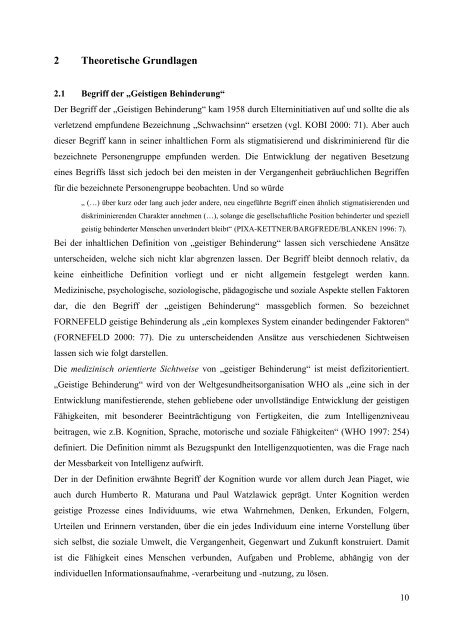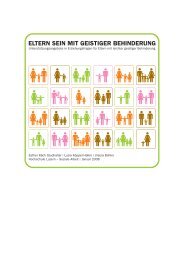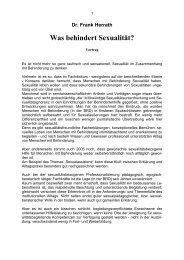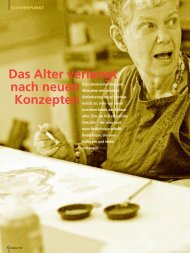Herunterladen PDF - Insieme
Herunterladen PDF - Insieme
Herunterladen PDF - Insieme
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2 Theoretische Grundlagen<br />
2.1 Begriff der „Geistigen Behinderung“<br />
Der Begriff der „Geistigen Behinderung“ kam 1958 durch Elterninitiativen auf und sollte die als<br />
verletzend empfundene Bezeichnung „Schwachsinn“ ersetzen (vgl. KOBI 2000: 71). Aber auch<br />
dieser Begriff kann in seiner inhaltlichen Form als stigmatisierend und diskriminierend für die<br />
bezeichnete Personengruppe empfunden werden. Die Entwicklung der negativen Besetzung<br />
eines Begriffs lässt sich jedoch bei den meisten in der Vergangenheit gebräuchlichen Begriffen<br />
für die bezeichnete Personengruppe beobachten. Und so würde<br />
„ (…) über kurz oder lang auch jeder andere, neu eingeführte Begriff einen ähnlich stigmatisierenden und<br />
diskriminierenden Charakter annehmen (…), solange die gesellschaftliche Position behinderter und speziell<br />
geistig behinderter Menschen unverändert bleibt“ (PIXA-KETTNER/BARGFREDE/BLANKEN 1996: 7).<br />
Bei der inhaltlichen Definition von „geistiger Behinderung“ lassen sich verschiedene Ansätze<br />
unterscheiden, welche sich nicht klar abgrenzen lassen. Der Begriff bleibt dennoch relativ, da<br />
keine einheitliche Definition vorliegt und er nicht allgemein festgelegt werden kann.<br />
Medizinische, psychologische, soziologische, pädagogische und soziale Aspekte stellen Faktoren<br />
dar, die den Begriff der „geistigen Behinderung“ massgeblich formen. So bezeichnet<br />
FORNEFELD geistige Behinderung als „ein komplexes System einander bedingender Faktoren“<br />
(FORNEFELD 2000: 77). Die zu unterscheidenden Ansätze aus verschiedenen Sichtweisen<br />
lassen sich wie folgt darstellen.<br />
Die medizinisch orientierte Sichtweise von „geistiger Behinderung“ ist meist defizitorientiert.<br />
„Geistige Behinderung“ wird von der Weltgesundheitsorganisation WHO als „eine sich in der<br />
Entwicklung manifestierende, stehen gebliebene oder unvollständige Entwicklung der geistigen<br />
Fähigkeiten, mit besonderer Beeinträchtigung von Fertigkeiten, die zum Intelligenzniveau<br />
beitragen, wie z.B. Kognition, Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten“ (WHO 1997: 254)<br />
definiert. Die Definition nimmt als Bezugspunkt den Intelligenzquotienten, was die Frage nach<br />
der Messbarkeit von Intelligenz aufwirft.<br />
Der in der Definition erwähnte Begriff der Kognition wurde vor allem durch Jean Piaget, wie<br />
auch durch Humberto R. Maturana und Paul Watzlawick geprägt. Unter Kognition werden<br />
geistige Prozesse eines Individuums, wie etwa Wahrnehmen, Denken, Erkunden, Folgern,<br />
Urteilen und Erinnern verstanden, über die ein jedes Individuum eine interne Vorstellung über<br />
sich selbst, die soziale Umwelt, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft konstruiert. Damit<br />
ist die Fähigkeit eines Menschen verbunden, Aufgaben und Probleme, abhängig von der<br />
individuellen Informationsaufnahme, -verarbeitung und -nutzung, zu lösen.<br />
10