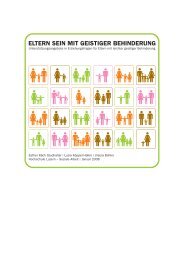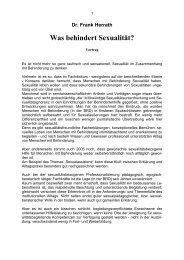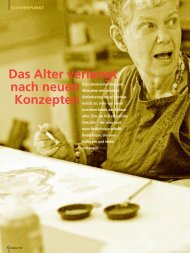Herunterladen PDF - Insieme
Herunterladen PDF - Insieme
Herunterladen PDF - Insieme
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Unterstützungsform, bei der die Hilfe nicht durch Fachpersonen organisiert ist, sondern durch<br />
das soziale Netz der Eltern oder des Elternteils geleistet wird.<br />
Als Voraussetzung für die Unterstützung von Eltern mit leichter und mittlerer geistiger<br />
Behinderung nennt SPARENBERG, dass diese von den Eltern akzeptiert ist, dass sie früh<br />
einsetzt und kontinuierlich fortgeführt wird (vgl. SPARENBERG 2001: 114). Oftmals bleibt die<br />
Angst der Eltern, dass ihnen das Kind doch noch weggenommen wird, wenn sie die elterlichen<br />
Aufgaben nicht alleine bewältigen. So ist es wichtig, dass ein Vertrauensverhältnis zwischen den<br />
Eltern und der Betreuungsperson aufgebaut wird, in dem diese Ängste thematisiert werden<br />
können und wenn die Unterstützung nicht genügt, alternative Unterstützungsformen angeboten<br />
werden können. Die Unterstützungsmassnahmen müssen immer individuell auf die Elternschaft<br />
zugeschnitten sein. Die Unterstützung sollte grundsätzlich Angebotscharakter haben. So besteht<br />
nicht die Gefahr, dass sie von den Eltern als kontrollierende Zwangsmassnahme verstanden wird.<br />
Besonders ambulante Unterstützungsangebote betonen zudem den Aspekt des Zusammenlebens<br />
von Eltern mit ihren Kindern in grösstmöglicher Selbständigkeit und Selbstbestimmung (vgl.<br />
BRENNER/WALTER 1999: 235). Denn, und das gilt auch für andere Unterstützungsangebote,<br />
Eltern sollten durch Unterstützung befähigt werden, die elterliche Verantwortung und die<br />
dazugehörenden Aufgaben wahrzunehmen und nicht durch Betreuungspersonen ersetzt werden.<br />
Dies kann, so PIXA-KETTNER, in eine „erlernte Hilflosigkeit“ münden (vgl. PIXA-KETTNER<br />
1998: 135).<br />
Die Problembereiche bei Elternschaften mit geistiger Behinderung nehmen einen grossen Platz<br />
in vorliegender Literatur zur Thematik ein. Die meisten AutorInnen zeigen die Problembereiche<br />
anhand eines Fallbeispiels einer Elternschaft auf. BRENNER/WALTER führen<br />
Problemebereiche bei Elternschaften von Menschen mit geistiger Behinderung auf, die anhand<br />
der Interviews im Rahmen der Untersuchung von BRENNER ersichtlich geworden sind<br />
(BRENNER/WALTER 1999: 231). Sie nennen hierbei beispielsweise Krisensituationen, die<br />
kognitive Beeinträchtigung der Eltern, die Erziehung der Kinder oder die alltägliche,<br />
altersgemässe Versorgung der Kinder. Spannend ist, dass sich die Aussagen der Eltern und der<br />
Betreuungspersonen in der Befragung nicht in allen Bereichen decken. Aber BRENNER weist<br />
darauf hin, dass die Problembereiche mit Ausnahme der kognitiven Einschränkungen, nicht<br />
unbedingt als behinderungsspezifisch zu bezeichnen sind (vgl. BRENNER/WALTER 1999:<br />
234). Solange sich die Eltern mit geistiger Behinderung ihrer Grenzen bewusst sind und Hilfen<br />
einfordern und auch annehmen können, ist den Problemen mit Unterstützung beizukommen.<br />
Allerdings gab es in der Untersuchung von PIXA-KETTNER/BARGFREDE/BLANKEN auch<br />
57