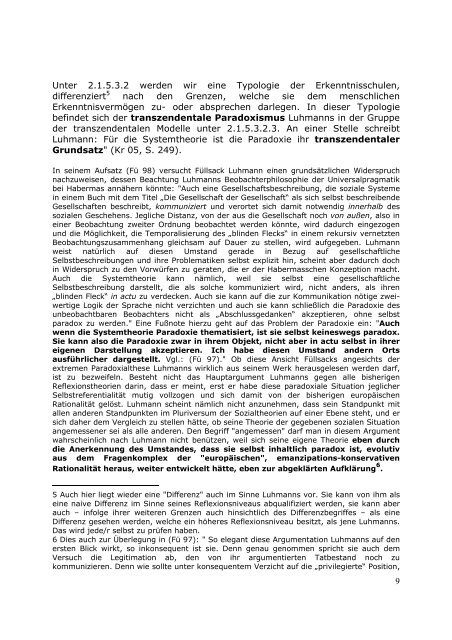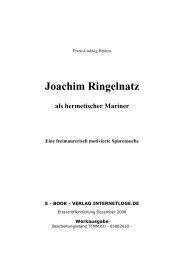Download gesamtes Buch: 206 S., PDF-File 4552 MB - Internetloge.de
Download gesamtes Buch: 206 S., PDF-File 4552 MB - Internetloge.de
Download gesamtes Buch: 206 S., PDF-File 4552 MB - Internetloge.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Unter 2.1.5.3.2 wer<strong>de</strong>n wir eine Typologie <strong>de</strong>r Erkenntnisschulen,<br />
differenziert 5 nach <strong>de</strong>n Grenzen, welche sie <strong>de</strong>m menschlichen<br />
Erkenntnisvermögen zu- o<strong>de</strong>r absprechen darlegen. In dieser Typologie<br />
befin<strong>de</strong>t sich <strong>de</strong>r transzen<strong>de</strong>ntale Paradoxismus Luhmanns in <strong>de</strong>r Gruppe<br />
<strong>de</strong>r transzen<strong>de</strong>ntalen Mo<strong>de</strong>lle unter 2.1.5.3.2.3. An einer Stelle schreibt<br />
Luhmann: Für die Systemtheorie ist die Paradoxie ihr transzen<strong>de</strong>ntaler<br />
Grundsatz" (Kr 05, S. 249).<br />
In seinem Aufsatz (Fü 98) versucht Füllsack Luhmann einen grundsätzlichen Wi<strong>de</strong>rspruch<br />
nachzuweisen, <strong>de</strong>ssen Beachtung Luhmanns Beobachterphilosophie <strong>de</strong>r Universalpragmatik<br />
bei Habermas annähern könnte: "Auch eine Gesellschaftsbeschreibung, die soziale Systeme<br />
in einem <strong>Buch</strong> mit <strong>de</strong>m Titel „Die Gesellschaft <strong>de</strong>r Gesellschaft“ als sich selbst beschreiben<strong>de</strong><br />
Gesellschaften beschreibt, kommuniziert und verortet sich damit notwendig innerhalb <strong>de</strong>s<br />
sozialen Geschehens. Jegliche Distanz, von <strong>de</strong>r aus die Gesellschaft noch von außen, also in<br />
einer Beobachtung zweiter Ordnung beobachtet wer<strong>de</strong>n könnte, wird dadurch eingezogen<br />
und die Möglichkeit, die Temporalisierung <strong>de</strong>s „blin<strong>de</strong>n Flecks“ in einem rekursiv vernetzten<br />
Beobachtungszusammenhang gleichsam auf Dauer zu stellen, wird aufgegeben. Luhmann<br />
weist natürlich auf diesen Umstand gera<strong>de</strong> in Bezug auf gesellschaftliche<br />
Selbstbeschreibungen und ihre Problematiken selbst explizit hin, scheint aber dadurch doch<br />
in Wi<strong>de</strong>rspruch zu <strong>de</strong>n Vorwürfen zu geraten, die er <strong>de</strong>r Habermasschen Konzeption macht.<br />
Auch die Systemtheorie kann nämlich, weil sie selbst eine gesellschaftliche<br />
Selbstbeschreibung darstellt, die als solche kommuniziert wird, nicht an<strong>de</strong>rs, als ihren<br />
„blin<strong>de</strong>n Fleck“ in actu zu ver<strong>de</strong>cken. Auch sie kann auf die zur Kommunikation nötige zweiwertige<br />
Logik <strong>de</strong>r Sprache nicht verzichten und auch sie kann schließlich die Paradoxie <strong>de</strong>s<br />
unbeobachtbaren Beobachters nicht als „Abschlussgedanken“ akzeptieren, ohne selbst<br />
paradox zu wer<strong>de</strong>n." Eine Fußnote hierzu geht auf das Problem <strong>de</strong>r Paradoxie ein: "Auch<br />
wenn die Systemtheorie Paradoxie thematisiert, ist sie selbst keineswegs paradox.<br />
Sie kann also die Paradoxie zwar in ihrem Objekt, nicht aber in actu selbst in ihrer<br />
eigenen Darstellung akzeptieren. Ich habe diesen Umstand an<strong>de</strong>rn Orts<br />
ausführlicher dargestellt. Vgl.: (Fü 97)." Ob diese Ansicht Füllsacks angesichts <strong>de</strong>r<br />
extremen Paradoxialthese Luhmanns wirklich aus seinem Werk herausgelesen wer<strong>de</strong>n darf,<br />
ist zu bezweifeln. Besteht nicht das Hauptargument Luhmanns gegen alle bisherigen<br />
Reflexionstheorien darin, dass er meint, erst er habe diese paradoxiale Situation jeglicher<br />
Selbstreferentialität mutig vollzogen und sich damit von <strong>de</strong>r bisherigen europäischen<br />
Rationalität gelöst. Luhmann scheint nämlich nicht anzunehmen, dass sein Standpunkt mit<br />
allen an<strong>de</strong>ren Standpunkten im Pluriversum <strong>de</strong>r Sozialtheorien auf einer Ebene steht, und er<br />
sich daher <strong>de</strong>m Vergleich zu stellen hätte, ob seine Theorie <strong>de</strong>r gegebenen sozialen Situation<br />
angemessener sei als alle an<strong>de</strong>ren. Den Begriff "angemessen" darf man in diesem Argument<br />
wahrscheinlich nach Luhmann nicht benützen, weil sich seine eigene Theorie eben durch<br />
die Anerkennung <strong>de</strong>s Umstan<strong>de</strong>s, dass sie selbst inhaltlich paradox ist, evolutiv<br />
aus <strong>de</strong>m Fragenkomplex <strong>de</strong>r "europäischen", emanzipations-konservativen<br />
Rationalität heraus, weiter entwickelt hätte, eben zur abgeklärten Aufklärung 6 .<br />
5 Auch hier liegt wie<strong>de</strong>r eine "Differenz" auch im Sinne Luhmanns vor. Sie kann von ihm als<br />
eine naive Differenz im Sinne seines Reflexionsniveaus abqualifiziert wer<strong>de</strong>n, sie kann aber<br />
auch – infolge ihrer weiteren Grenzen auch hinsichtlich <strong>de</strong>s Differenzbegriffes – als eine<br />
Differenz gesehen wer<strong>de</strong>n, welche ein höheres Reflexionsniveau besitzt, als jene Luhmanns.<br />
Das wird je<strong>de</strong>/r selbst zu prüfen haben.<br />
6 Dies auch zur Überlegung in (Fü 97): " So elegant diese Argumentation Luhmanns auf <strong>de</strong>n<br />
ersten Blick wirkt, so inkonsequent ist sie. Denn genau genommen spricht sie auch <strong>de</strong>m<br />
Versuch die Legitimation ab, <strong>de</strong>n von ihr argumentierten Tatbestand noch zu<br />
kommunizieren. Denn wie sollte unter konsequentem Verzicht auf die „privilegierte“ Position,<br />
9