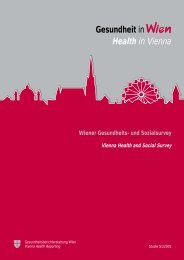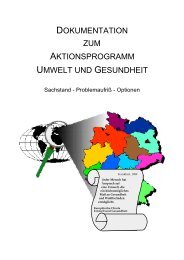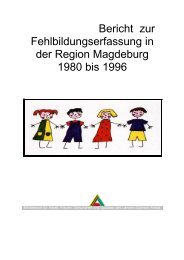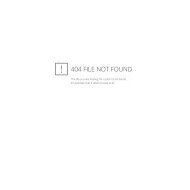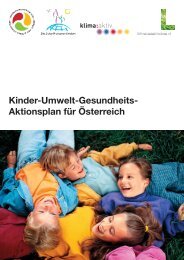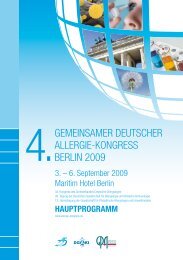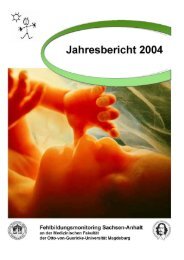Bericht - Der Landtag von Sachsen-Anhalt
Bericht - Der Landtag von Sachsen-Anhalt
Bericht - Der Landtag von Sachsen-Anhalt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die Jugendsozialarbeit mit ihren Maßnahmen und Angeboten der beruflichen und sozialen<br />
Integration <strong>von</strong> sozial benachteiligten bzw. individuell beeinträchtigten Jugendlichen und jungen<br />
Erwachsenen verteilt sich auf ganz unterschiedliche Arbeitsfelder, wie<br />
• die Jugendberufshilfe,<br />
• die Schulsozialarbeit,<br />
• die Senkung der Zahl junger Menschen ohne Schulabschluss,<br />
• die Arbeit mit ausländischen Jugendlichen,<br />
• die Eingliederungshilfe für junge Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen und<br />
• die geschlechtsspezifische Sozialarbeit.<br />
Die Gruppe der jungen Menschen ohne Schulabschluss und ohne abgeschlossene Berufsausbildung,<br />
Menschen, die also eine Ausbildung nicht aufgenommen, diese abgebrochen<br />
oder nicht bestanden haben, trägt das höchste Risiko, dauerhaft arbeitslos zu sein. Sie stellen<br />
eine besondere Herausforderung dar. Neben dem demographischen Wandel sind auch<br />
die veränderten gesellschaftlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen wesentliche Einflussfaktoren.<br />
Das Leitmotiv der Jugendsozialarbeit „Lebensbewältigung durch Integration in<br />
Arbeit und Beruf“ muss daher konzeptionell im Sinne einer Erweiterung der bisherigen Antworten<br />
und programmatischen Anpassung der Konzepte und Angebote weiterentwickelt und<br />
zielgruppenspezifisch ausdifferenziert werden. Das führt dazu, dass die Bedarfslagen <strong>von</strong><br />
Jugendlichen mit Migrationshintergrund aber auch <strong>von</strong> Mädchen und jungen Frauen stärker<br />
berücksichtigt werden müssen. Enge Kooperationen insbesondere mit Ausbildungsbetrieben,<br />
Handwerkskammern, Unternehmen, Gewerkschaften und der Aufbau regionaler Kooperationsstrukturen<br />
bilden die notwendigen Voraussetzungen. Notwendig sind neben Präventionsansätzen<br />
konkrete Förderangebote der Jugendberufshilfe im Rahmen der regionalen SGB II-<br />
Flankierung mit einer Stärkung niedrigschwelliger Qualifizierungsangebote für arbeitslose<br />
Jugendliche, aufbaufähige Arbeitsgelegenheiten für ALG II-Empfängerinnen und -Empfänger<br />
unter 25 Jahren, berufsorientierte Qualifizierungsangebote sowie Nachholen <strong>von</strong> Schulabschlüssen.<br />
Ferner gehören dazu praktizierte Konzepte zur niedrigschwelligen, intensiven, zeitlich befristeten<br />
Arbeit mit mehrfachbelasteten Familien. Ein unzureichender Ausbau dieser Angebote<br />
begünstigt die Notwendigkeit einer Inanspruchnahme erzieherischer Hilfen. Die ständige Optimierung<br />
der Problemwahrnehmung durch die Jugendämter muss beibehalten werden.<br />
Durch die erhöhte Sensibilisierung und rechtliche Verankerung des Kinderschutzes im § 8a<br />
SGB VIII werden Kinder und Jugendliche in kritischen Lebenslagen heute schon deutlicher<br />
wahrgenommen.<br />
Es wird zunehmend auch darum gehen, Jugendhilfeleistungen schon im Vorfeld der erzieherischen<br />
Hilfen zu finanzieren und vorhandene fachliche und finanzielle Ressourcen zu nutzen,<br />
indem im größerem Umfang präventive gemeinwesenorientierte Maßnahmen eingesetzt<br />
und evaluiert werden, statt im Bezug auf individuelle Problemlagen <strong>von</strong> Kindern stets mit<br />
Einzelhilfen zu reagieren (Vgl. auch Zehnter Kinder- und Jugendbericht des Bundes (1989),<br />
Seiten 267 und 269).<br />
Zum Ausgleich sozialer Benachteiligung im Bereich Erziehung und Bildung ist die Zusammenarbeit<br />
zwischen Schule und Jugendhilfe auf den Weg gebracht worden. Beim Auftauchen<br />
<strong>von</strong> Erziehungsproblemen und schulischer Überforderung können so gemeinsam abgestimmte<br />
Unterstützungssysteme für Eltern, Kinder und Jugendliche greifen.<br />
Die Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt müssen mit der Lebenswirklichkeit <strong>von</strong> Familien<br />
kompatibel werden. Dabei ist das Thema Vereinbarkeit <strong>von</strong> Beruf und Familie auch für Führungskräfte<br />
in den Blick zu nehmen. Familienbewusste, kooperative Personalpolitik ist als<br />
Chance zu begreifen, die sich zu einem harten Standortfaktor konkretisiert und zu einer Steigerung<br />
der Wettbewerbsfähigkeit in der Wirtschaft führen kann. Je höher die demographische<br />
Belastung einer Region (Altersstruktur, Fachkräftemangel), umso stärker wirkt die familienfreundliche<br />
Kultur ansässiger Unternehmen der Abwanderung entgegen bzw. unterstützt<br />
sie die Realisierung eines Kinderwunsches potentieller Eltern.<br />
104