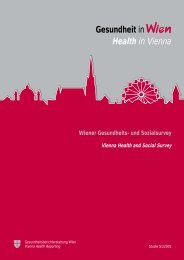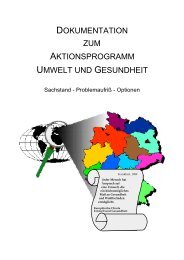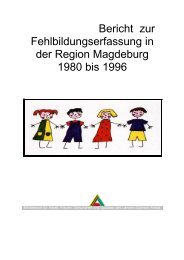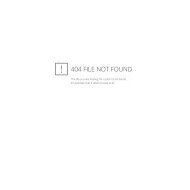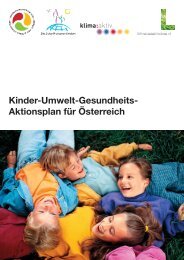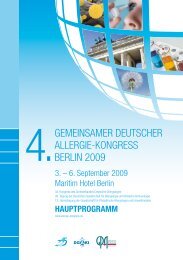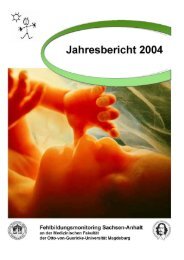Bericht - Der Landtag von Sachsen-Anhalt
Bericht - Der Landtag von Sachsen-Anhalt
Bericht - Der Landtag von Sachsen-Anhalt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
forderungen, die immer auch eng an Gesundheit und Leistungsfähigkeit gebunden sind,<br />
besser bewältigt werden können. In den Lebenswelten („Settings“) muss es daher gelingen,<br />
• die Voraussetzungen zu schaffen und zu verbessern, sich gesünder zu ernähren, sich<br />
mehr zu bewegen und die Herausforderungen des Alltags besser bewältigen zu können,<br />
• mit Vorbildern und Anreizen die Menschen zu motivieren, mehr für die eigene Gesundheit<br />
zu tun und<br />
• konkrete Angebote für Menschen und Bevölkerungsgruppen anzubieten, die bisher kaum<br />
Zugang zu gesundheitsförderlichen Angeboten hatten.<br />
Es gilt, die Lücke zwischen dem Wissen über einen gesunden Lebensstil und der Anwendung<br />
<strong>von</strong> gesundheitsförderlichem Verhalten zu erkennen und zu schließen. Dabei geht es<br />
insbesondere darum, verständliche und alltagstaugliche Informationen zu vermitteln.<br />
Die Maßnahmen zu den Gesundheitszielen sollen dauerhafte und nachhaltige Änderungen<br />
bewirken. Das erfordert eine auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnittene Ansprache. Nur so<br />
kann die Bereitschaft für eine gesunde Lebensweise quer durch die Bevölkerung nachhaltig<br />
geweckt und gefördert werden, sozusagen vom Kita–Kind bis zum ältesten Menschen.<br />
3.1.2 Entwicklungen und Befunde<br />
In der Schulanfängerstudie <strong>Sachsen</strong>-<strong>Anhalt</strong> wurde besonderes Augenmerk auf die sozialen<br />
Rahmenbedingungen gerichtet, unter denen die einzuschulenden Kinder aufwachsen und<br />
leben. Es wurde versucht, anhand des Sozialstatus jene Faktoren zu erfassen, die maßgeblich<br />
die gesunde Entwicklung der Kinder beeinflussen. Es wurden der Bildungs- und der Beschäftigungsstatus<br />
der Eltern erfasst und aus diesen Angaben wurde eine Definition „sozialer<br />
Status“ in Anlehnung an die Empfehlung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Epidemiologie<br />
(DAE) erarbeitet (auch wenn im Fragebogen die Angabe zum Einkommen, in der DAE-<br />
Empfehlung neben Bildung und Beruf als dritter zentraler Aspekt sozialer Schichtung genannt,<br />
nicht erfragt wurde).<br />
Kinder aus Familien mit hohem Sozialstatus litten häufiger an allergischen Erkrankungen,<br />
besonders an Ekzem bzw. Neurodermitis, sowie an Pseudokrupp. Dagegen waren Kinder<br />
aus Familien mit niedrigem Sozialstatus eher anfällig gegen Erkältungskrankheiten.<br />
Das Eintrittsalter der Kinder in die Kinderkrippe bzw. in den Kindergarten ist deutlich gesunken,<br />
d.h. die Kinder besuchen in einem viel früheren Lebensalter die Kindereinrichtungen.<br />
Hierbei sind es besonders die Kinder aus Familien mit hohem Sozialstatus, die jetzt früher<br />
eine Kindereinrichtung besuchen. Insgesamt ist auch der Anteil der Kinder, die nie eine Kindereinrichtung<br />
besucht haben, deutlich gesunken (auch bei niedrigem sozialem Status).<br />
<strong>Der</strong> Einfluss des Sozialstatus auf die Wohnsituation einzuschulender Kinder war deutlich:<br />
Kindern aus Familien mit niedrigem Sozialstatus stand weniger Wohnfläche zur Verfügung,<br />
sie lebten häufiger in unsanierten Wohnungen und in Wohnungen, die näher an verkehrsreichen<br />
Straßen lagen.<br />
Beim Stillen der Kinder, besonders auch beim Vollstillen, war über den gesamten Untersuchungszeitraum<br />
seit 1991 in allen Untersuchungsorten eine stetige Zunahme zu verzeichnen.<br />
Dabei stillten Mütter mit hohem Sozialstatus, „ältere“ Mütter und Mütter mit ausländischem<br />
Hintergrund ihre Kinder häufiger und länger. Negativ auf die Stillhäufigkeit und Stilldauer<br />
wirkten sich das Rauchen der Mutter während der Schwangerschaft sowie das Leben<br />
in einer Raucherwohnung aus.<br />
<strong>Der</strong> Anteil übergewichtiger Kinder, der Kinder mit Adipositas bzw. extremer Adipositas hat<br />
über den Gesamtzeitraum seit 1991 deutlich zugenommen. Kinder aus Familien mit niedrigem<br />
Sozialstatus stellten dabei den höchsten Anteil übergewichtiger und adipöser Kinder.<br />
Gleiches galt für den BMI (Körpermasse/Quadrat der Körpergröße), der gegenüber Kindern<br />
aus Familien mit hohem Sozialstatus deutlich erhöht war.<br />
Ein Drittel der erfassten Kinder war dem Passiv-Rauchen in der elterlichen Wohnung ausgesetzt.<br />
Obwohl der Trend des Rauchens in der Wohnung in allen Untersuchungsorten erfreu-<br />
119