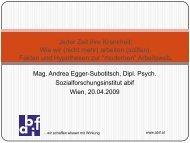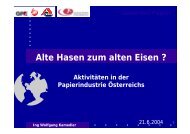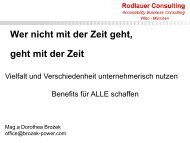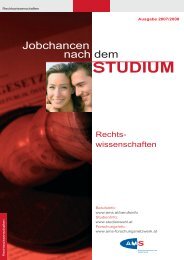Praxishandbuch - bei abif
Praxishandbuch - bei abif
Praxishandbuch - bei abif
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Praxishandbuch</strong>: Methoden in der Berufl ichen Rehabilitation<br />
6 Zukunft der berufl ichen Rehabilitation<br />
6.1 Early Intervention und Prävention<br />
Während in den letzten Jahren die Anzahl der Ar<strong>bei</strong>ts- und Wegunfälle zurückgegangen ist, steigen die chronischen Erkrankungen<br />
stark an. Die Ursachen sind vielfältig und sind eng mit den Ar<strong>bei</strong>ts- und Lebensbedingungen verknüpft. Fest<br />
steht: Chronifi zierte Erkrankungen verursachen für die betroffenen Menschen viel Leid und für die Volkswirtschaft hohe<br />
Kosten.<br />
Präventive Maßnahmen haben daher zum Ziel:<br />
• Gesundheit zu erhalten (primäre Prävention)<br />
Durch Verhaltensänderung sollen gesundheitsgefährdende Einfl üsse reduziert werden (z. B. Sucht, Übergewicht, hoher<br />
Blutdruck). Oft fühlt sich der Mensch gesund und weiß (noch nichts) über die möglichen Auswirkungen seines Verhaltens.<br />
Die Verhaltensprävention <strong>bei</strong>nhaltet daher eine stark sensibilisierende und aufklärende Komponente.<br />
Durch Verhältnisprävention sollen gesundheitsgefährdende Umstände und Bedingungen „korrigiert“ werden (wie z. B.<br />
belastende Faktoren am Ar<strong>bei</strong>tsplatz, Lärm, Feinstaub). Bekannt sind diese Maßnahmen und Programme unter dem<br />
Begriff „Gesundheitsförderung“ und „Vorbeugung“.<br />
• Durch Früherkennung und „rechtzeitig“ gesetzte Maßnahmen, Gesundheit rasch wiederherstellen zu können<br />
(sekundäre Prävention)<br />
Die Chance und der Nutzen dieser Maßnahmen liegen in der Möglichkeit einer rechtzeitigen Behandlung oder Intervention<br />
bevor eine Chronifi zierung oder ein irreversibler Zustand eintritt. Typische Bestandteile der sekundären Prävention<br />
im Allgemeinen sind ein Screening oder Vorsorgeuntersuchungen, die ein Aufzeigen einer z. B. symptomlosen<br />
Erkrankung ermöglichen. Ein Screening wird aufgrund unspezifi scher (d. h. nicht diagnostizierte) Symptome durchgeführt<br />
(z. B. Alkoholkonsum, Schwierigkeiten im Umgang mit Geld, Stimmungsschwankungen), die einer Klärung<br />
zugeführt werden sollten, um bereits im Anfangsstadium von Problemen bzw. Erkrankungen Maßnahmen setzen zu<br />
können.<br />
Exkurs zur sekundären Prävention:<br />
In der Berufl ichen Rehabilitation sind der Nutzen und die Wirksamkeit von sekundärer Prävention von großer Bedeutung,<br />
aber noch wenig bekannt. Die Wiedererlangung bzw. -herstellung der Ar<strong>bei</strong>tsfähigkeit ist eines ihrer zentralen Ziele, vor<br />
allem im Kontext der Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspensionen und der Pensionsreform. Länger ar<strong>bei</strong>ten müssen,<br />
setzt eine Ar<strong>bei</strong>ts- und Leistungsfähigkeit bis zum Pensionsantrittsalter voraus. In Österreich befi nden sich im Jahr 2004<br />
ca. ein Fünftel aller Pensionisten wegen geminderter Erwerbsfähigkeit in einer Invaliditäts / -Berufsunfähigkeitspension.<br />
Das Durchschnittsalter für den Pensionsantritt beträgt 52 Jahre (Männer: 54 Jahre, Frauen: 50 Jahre). 152 Laut OECD ar<strong>bei</strong>tet<br />
in Österreich nur mehr jeder Dritte der 55- bis 64-jährigen Menschen. Damit hat Österreich in dieser Altersgruppe<br />
eine der weltweit niedrigsten Erwerbsquoten. Die Ursache liegt u. a. darin, dass Menschen in belastenden Berufen (wie<br />
z. B. Bauar<strong>bei</strong>terInnen, Pfl egepersonal) nicht rechtzeitig, d. h. in jüngeren Jahren, auf weniger belastende Tätigkeiten umgeschult<br />
werden, um sie länger im Erwerbsleben halten zu können.<br />
Auch junge Menschen sind in ihrer Ar<strong>bei</strong>tsfähigkeit gefährdet, allerdings weniger in ihrer Gesundheit, sondern eher in<br />
lebensbegleitenden Umständen, hier setzt Sucht- oder Schuldenprävention an. Sekundäre Prävention setzt mithin <strong>bei</strong> drohender<br />
Gefahr an – entscheidend ist hier, dass diese Gefahren von ExpertInnen erkannt und behandelt werden.<br />
152 Vgl. Bericht 2004 des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger.<br />
<strong>abif</strong> – analyse beratung und interdisziplinäre forschung • AMS Österreich, ABI / Ar<strong>bei</strong>tsmarktforschung und Berufsinformation • BBRZ Reha GesmbH<br />
108