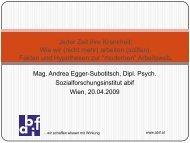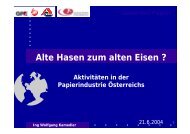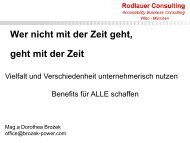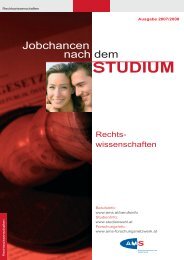Praxishandbuch - bei abif
Praxishandbuch - bei abif
Praxishandbuch - bei abif
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Praxishandbuch</strong>: Methoden in der Berufl ichen Rehabilitation<br />
Überwachung – Controlling ➪ Zwischenauswertung<br />
Auswertung – Evaluation / Beendigung –<br />
Disengagement ➪<br />
Überprüfung der bisherigen Bewertung<br />
Überprüfung der Zielerreichung<br />
Beobachtung der Veränderungen im Behandlungsverlauf<br />
Begleitung der RehabilitandInnen zu Behörden (Versicherungen etc.)<br />
Auswertung und Beendigung des Hilfeprozesses<br />
Fallübergabe (weiterbehandelnde Einrichtungen etc.)<br />
Vernetzung der Hilfen / Weiterleitung von Informationen<br />
Qualitätskontrolle und -nachweis<br />
Dokumentation<br />
Neben dem hier skizzierten Case Management, kommen im Bereich des Berufl ichen Rehabilitationsmanagements noch<br />
folgende Konzepte / Methoden zum Einsatz, die sich im Wesentlichen aber an den Ar<strong>bei</strong>tsschritten des CM orientieren: 92<br />
• Fallmanagement: Optimierung der Hilfe im konkreten Einzelfall (Einzelfallhilfe);<br />
• Systemmanagement: Optimierung der Versorgung im jeweiligen Zuständigkeitsbereich einer Organisation in der Rehabilitationskette;<br />
• Care-Management: Führung / Begleitung einer einzelnen Person im Rehabilitationsprozess mit dem Ziel, optimale<br />
Rehabilitationsleistungen zu gewährleisten.<br />
Ziel aller CM-Strategien ist die bestmögliche Abstimmung und Optimierung des konkreten Unterstützungsbedarfs für RehabilitandInnen<br />
unter Einbezug dessen / derer aktiver Beteiligung.<br />
2.7 Paradigma der Salutogenese<br />
Die Bedeutungszunahme eines ganzheitlich-integrierten bzw. biografi sch-lebensweltorientierten Rehabilitationsansatzes ist<br />
vor allem auf einen generellen Paradigmenwechsel von der Pathogenese zur Salutogenese im Kranken- bzw. Gesundheitswesen<br />
und so auch im Rehabilitationswesen zurückzuführen. Salutogenese versteht sich als Gegensatz zur (in der Medizin<br />
verbreiteten) Pathogenese: Anstatt nach den Ursachen von Krankheiten zu suchen, forscht die Salutogenese nach den<br />
„Kräften und Wirkungen, die Menschen gesund erhalten – selbst unter prekären Bedingungen (Rehabilitation). Anstelle<br />
der üblichen dichotomen Unterscheidung von Gesundheit und Krankheit, wird hier Gesundheit umfassend als multidimensionales<br />
Kontinuum zwischen den Extrempositionen maximaler und minimaler Gesundheit verstanden.“ 93<br />
Die wesentlichen Fragen da<strong>bei</strong> sind: Was ist Gesundheit? Ist Gesundheit tatsächlich nur die Abwesenheit von Krankheit<br />
oder nicht vielmehr auch das Vorhandensein von Lebensqualität? Wie ist Gesundheit zu fördern? Und wie lassen sich<br />
(gesunde oder bereits erkrankte) Menschen zu gesundem Leben motivieren?<br />
Das salutogenetische Modell von Aaron Antonovsky, das von einem erweiterten Gesundheitsverständnis ausgeht, und die<br />
Ottawa-Charta (WHO) prägen heute maßgeblich die Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und ebenso die Maßnahmen<br />
in der Rehabilitation. In diesem Paradigma gewinnen psychosomatische, soziomatische und ökosoziale Zusammenhänge<br />
an Bedeutung für den Lebensalltag. 94<br />
92 Vgl. Mühlum / Gödecker-Geenen 2003, Seite 110.<br />
93 Mühlum / Gödecker-Geenen, 2003, Seite 104f.<br />
94 Vgl. ebenda.<br />
<strong>abif</strong> – analyse beratung und interdisziplinäre forschung • AMS Österreich, ABI / Ar<strong>bei</strong>tsmarktforschung und Berufsinformation • BBRZ Reha GesmbH<br />
37<br />
Grundlagen der Ar<strong>bei</strong>t in der Rehabilitation