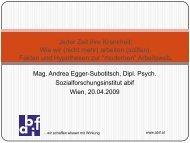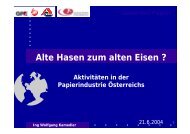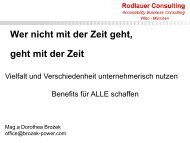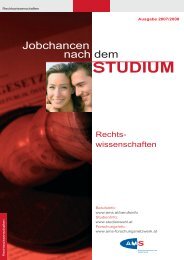Praxishandbuch - bei abif
Praxishandbuch - bei abif
Praxishandbuch - bei abif
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Praxishandbuch</strong>: Methoden in der Berufl ichen Rehabilitation<br />
Quelle: Andrea Egger / Elisabeth Simbürger / Karin Steiner 2003, Seite 54.<br />
Methoden<br />
Beschreibung der Methode: Der / Die TrainerIn teilt ein Handout aus (vgl. Tabelle). Die Fragen in der Tabelle sollten<br />
die TeilnehmerInnen sich selbst, ihrer Familie, ihren FreundInnen und Bekannten stellen. Erfolgt die Fremdeinschätzung<br />
durch eine / n TeilnehmerIn im Kurs, gehen zuvor die TeilnehmerInnen paarweise zusammen.<br />
Checkliste: Stärken- und Schwächenprofi l<br />
Fragestellung Selbsteinschätzung (Selbstbild) Fremdeinschätzung (Fremdbild)<br />
Welche besonderen Fähigkeiten<br />
besitze ich?<br />
Was beherrsche ich wirklich gut?<br />
Was schätzen meine FreundInnen / was<br />
schätzt meine Familie an mir?<br />
Welche Tätigkeiten bereiten mir<br />
Schwierigkeiten?<br />
Auf welchen Gebieten muss ich noch an<br />
mir ar<strong>bei</strong>ten?<br />
Welcher Berufsbereich ist nichts für mich?<br />
Durch Gegenüberstellung Selbst- und Fremdbild kann der / die TeilnehmerIn feststellen, wo seine / ihre Wirkung stark streut<br />
und wo seine / ihre vermutete Wirkung von der tatsächlichen Wirkung stark abweicht.<br />
Dauer: 1 Stunde bzw. 1 Tag.<br />
Vorbereitung / Material: Kopiervorlage.<br />
Anmerkungen: Der zweite Teil der Übung (Fremdeinschätzung) dient entweder als Hausübung oder als Übung in der<br />
Zweiergruppe. Die Übung ist insofern heikel, als da<strong>bei</strong> auch Eigenschaften / Zuschreibungen herauskommen können, die<br />
den TeilnehmerInnen nicht gefallen. Es können aber auch Stärken zum Vorschein treten, die von den TeilnehmerInnen nicht<br />
gewollt sind. Zusätzlich kann auch der Fall eintreten, dass der / die TeilnehmerIn kein positives oder negatives Feedback<br />
annehmen kann. Da das Bewusstwerden der eigenen Schwächen und (ungewollten) Stärken (= Annehmen der eigenen Person)<br />
und auch die Auseinandersetzung mit der Fremdeinschätzung aber als wesentlicher Motor für Verhaltensänderungen<br />
fungiert, ist dies ein wichtiger Schritt in der Ressourcenorientierung. Den TeilnehmerInnen sollte für die Übung (Selbstbild)<br />
genügend Zeit gegeben werden. Wichtig ist, dass vor der Übung auf jeden Fall Feedback-Regeln (Feedback-Regeln siehe<br />
Kapitel 7: Glossar) durchgenommen werden. „Feedbackgeben“ sollte auch schon vorher in der Gruppe geübt werden.<br />
Zahlreiche andere Methoden zur Ressourcenorientierung fi nden Sie im <strong>Praxishandbuch</strong>: Methoden der allgemeinen Berufs-<br />
und Ar<strong>bei</strong>tsmarktorientierung, Wien 2006 (Download unter www.ams-forschungsnetzwerk.at).<br />
3.1.5 Biografi sche Diagnostik<br />
In der biografi schen Diagnostik geht es um den wissenschaftlich kontrollierten Nachvollzug der individuellen Lebensgeschichte<br />
als Handlungsfi gur. Eine Beziehung zwischen der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Lebensgeschichte<br />
wird durch das Verknüpfen neuer Erfahrungen mit bisher bestehenden Erfahrungen (dem Erfahrungsvorrat) hergestellt.<br />
„Biografi sches Lernen“ ist demnach ein „Lernen aus Erfahrung“. Im wesentlichen ist es ein individueller, lebensgeschichtlich<br />
relevanter Bildungsprozess und wird als „biografi sche Bildungsar<strong>bei</strong>t“ beschrieben. 107<br />
107 Vgl. Preißer 2002, Seite 9–31.<br />
<strong>abif</strong> – analyse beratung und interdisziplinäre forschung • AMS Österreich, ABI / Ar<strong>bei</strong>tsmarktforschung und Berufsinformation • BBRZ Reha GesmbH<br />
63