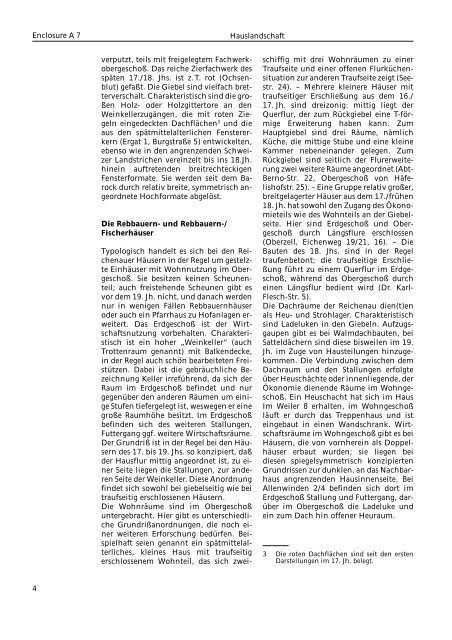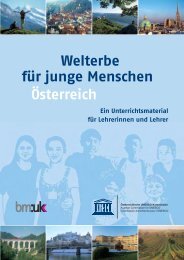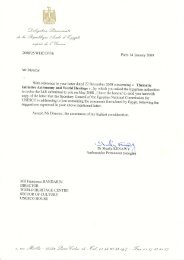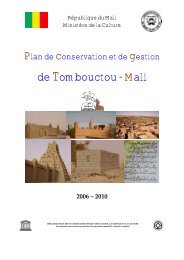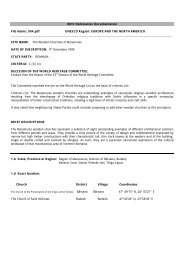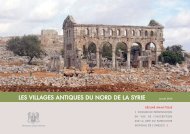Monastic Island of Reicheneau - UNESCO: World Heritage
Monastic Island of Reicheneau - UNESCO: World Heritage
Monastic Island of Reicheneau - UNESCO: World Heritage
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Enclosure A 7 Hauslandschaft<br />
4<br />
verputzt, teils mit freigelegtem Fachwerkobergeschoß.<br />
Das reiche Zierfachwerk des<br />
späten 17./18. Jhs. ist z.T. rot (Ochsenblut)<br />
gefaßt. Die Giebel sind vielfach bretterverschalt.<br />
Charakteristisch sind die großen<br />
Holz- oder Holzgittertore an den<br />
Weinkellerzugängen, die mit roten Ziegeln<br />
eingedeckten Dachflächen 3 und die<br />
aus den spätmittelalterlichen Fenstererkern<br />
(Ergat 1, Burgstraße 5) entwickelten,<br />
ebenso wie in den angrenzenden Schweizer<br />
Landstrichen vereinzelt bis ins 18.Jh.<br />
hinein auftretenden breitrechteckigen<br />
Fensterformate. Sie werden seit dem Barock<br />
durch relativ breite, symmetrisch angeordnete<br />
Hochformate abgelöst.<br />
Die Rebbauern- und Rebbauern-/<br />
Fischerhäuser<br />
Typologisch handelt es sich bei den Reichenauer<br />
Häusern in der Regel um gestelzte<br />
Einhäuser mit Wohnnutzung im Obergeschoß.<br />
Sie besitzen keinen Scheunenteil;<br />
auch freistehende Scheunen gibt es<br />
vor dem 19. Jh. nicht, und danach werden<br />
nur in wenigen Fällen Rebbauernhäuser<br />
oder auch ein Pfarrhaus zu H<strong>of</strong>anlagen erweitert.<br />
Das Erdgeschoß ist der Wirtschaftsnutzung<br />
vorbehalten. Charakteristisch<br />
ist ein hoher „Weinkeller“ (auch<br />
Trottenraum genannt) mit Balkendecke,<br />
in der Regel auch schön bearbeiteten Freistützen.<br />
Dabei ist die gebräuchliche Bezeichnung<br />
Keller irreführend, da sich der<br />
Raum im Erdgeschoß befindet und nur<br />
gegenüber den anderen Räumen um einige<br />
Stufen tiefergelegt ist, weswegen er eine<br />
große Raumhöhe besitzt. Im Erdgeschoß<br />
befinden sich des weiteren Stallungen,<br />
Futtergang ggf. weitere Wirtschaftsräume.<br />
Der Grundriß ist in der Regel bei den Häusern<br />
des 17. bis 19. Jhs. so konzipiert, daß<br />
der Hausflur mittig angeordnet ist, zu einer<br />
Seite liegen die Stallungen, zur anderen<br />
Seite der Weinkeller. Diese Anordnung<br />
findet sich sowohl bei giebelseitig wie bei<br />
traufseitig erschlossenen Häusern.<br />
Die Wohnräume sind im Obergeschoß<br />
untergebracht. Hier gibt es unterschiedliche<br />
Grundrißanordnungen, die noch einer<br />
weiteren Erforschung bedürfen. Beispielhaft<br />
seien genannt ein spätmittelalterliches,<br />
kleines Haus mit traufseitig<br />
erschlossenem Wohnteil, das sich zwei-<br />
schiffig mit drei Wohnräumen zu einer<br />
Traufseite und einer <strong>of</strong>fenen Flurküchensituation<br />
zur anderen Traufseite zeigt (Seestr.<br />
24). – Mehrere kleinere Häuser mit<br />
traufseitiger Erschließung aus dem 16./<br />
17. Jh. sind dreizonig: mittig liegt der<br />
Querflur, der zum Rückgiebel eine T-förmige<br />
Erweiterung haben kann. Zum<br />
Hauptgiebel sind drei Räume, nämlich<br />
Küche, die mittige Stube und eine kleine<br />
Kammer nebeneinander gelegen. Zum<br />
Rückgiebel sind seitlich der Flurerweiterung<br />
zwei weitere Räume angeordnet (Abt-<br />
Berno-Str. 22, Obergeschoß von Häfelish<strong>of</strong>str.<br />
25). – Eine Gruppe relativ großer,<br />
breitgelagerter Häuser aus dem 17./frühen<br />
18. Jh. hat sowohl den Zugang des Ökonomieteils<br />
wie des Wohnteils an der Giebelseite.<br />
Hier sind Erdgeschoß und Obergeschoß<br />
durch Längsflure erschlossen<br />
(Oberzell, Eichenweg 19/21, 16). – Die<br />
Bauten des 18. Jhs. sind in der Regel<br />
traufenbetont; die traufseitige Erschließung<br />
führt zu einem Querflur im Erdgeschoß,<br />
während das Obergeschoß durch<br />
einen Längsflur bedient wird (Dr. Karl-<br />
Flesch-Str. 5).<br />
Die Dachräume der Reichenau dien(t)en<br />
als Heu- und Strohlager. Charakteristisch<br />
sind Ladeluken in den Giebeln. Aufzugsgaupen<br />
gibt es bei Walmdachbauten, bei<br />
Satteldächern sind diese bisweilen im 19.<br />
Jh. im Zuge von Hausteilungen hinzugekommen.<br />
Die Verbindung zwischen dem<br />
Dachraum und den Stallungen erfolgte<br />
über Heuschächte oder innenliegende, der<br />
Ökonomie dienende Räume im Wohngeschoß.<br />
Ein Heuschacht hat sich im Haus<br />
Im Weiler 8 erhalten, im Wohngeschoß<br />
läuft er durch das Treppenhaus und ist<br />
eingebaut in einen Wandschrank. Wirtschaftsräume<br />
im Wohngeschoß gibt es bei<br />
Häusern, die von vornherein als Doppelhäuser<br />
erbaut wurden; sie liegen bei<br />
diesen spiegelsymmetrisch konzipierten<br />
Grundrissen zur dunklen, an das Nachbarhaus<br />
angrenzenden Hausinnenseite. Bei<br />
Allenwinden 2/4 befinden sich dort im<br />
Erdgeschoß Stallung und Futtergang, darüber<br />
im Obergeschoß die Ladeluke und<br />
ein zum Dach hin <strong>of</strong>fener Heuraum.<br />
3 Die roten Dachflächen sind seit den ersten<br />
Darstellungen im 17. Jh. belegt.