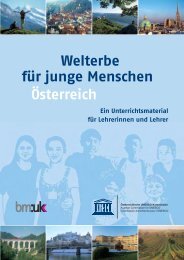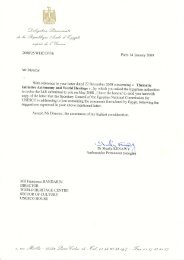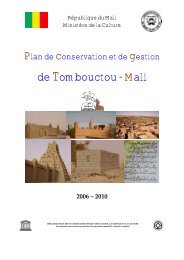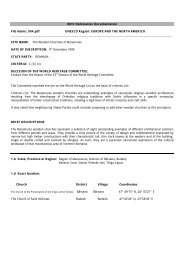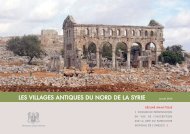Monastic Island of Reicheneau - UNESCO: World Heritage
Monastic Island of Reicheneau - UNESCO: World Heritage
Monastic Island of Reicheneau - UNESCO: World Heritage
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1. Einleitung: Fragestellung,<br />
methodische Grundlagen und<br />
Bewertungskriterien<br />
Die heutige, durch intensiven Gemüsebau<br />
geprägte Agrarlandschaft der im Bodensee<br />
gelegenen Insel Reichenau ist hervorgegangen<br />
aus einer unter der Herrschaft des<br />
Reichenauer Klosters betriebenen Landwirtschaft,<br />
die für historische Zeiten durchaus<br />
als intensiv zu bezeichnen ist – dabei<br />
jedoch nicht auf die Selbstversorgung der<br />
gesamten dort lebenden Bevölkerung ausgerichtet<br />
war. Diverse, für die Landwirtschaft<br />
wichtige Produkte wurden vor allem<br />
von Allensbach – einer Marktgründung<br />
der Reichenauer Mönche – per Schiff<br />
auf die Insel geliefert. Trotz dieser zahlreichen,<br />
hier nur angedeuteten wirtschaftlichen<br />
und herrschaftspolitischen Verflechtungen<br />
zwischen der Insel und der sie<br />
umgebenden Bodenseeregion ist es angesichts<br />
der Insellage sowie vor allem auch<br />
im Hinblick auf die einzigartige Geschichte<br />
dieses Eilands gerechtfertigt, die Reichenau<br />
zunächst gesondert zu betrachten.<br />
Zweifelsohne ist die Geschichte des Klosters<br />
auf der Insel Reichenau außergewöhnlich.<br />
Von Pirmin im 8. Jahrhundert<br />
gegründet, zählte das Kloster zunächst zu<br />
den großen Stätten mittelalterlicher Geistlichkeit.<br />
Seine Wirkung reichte weit über<br />
die gänzlich dem Herrschaftsbereich des<br />
Klosters zugesprochene Insel hinaus. Der<br />
Name Reichenau hat selbst heute noch,<br />
fast zweihundert Jahre nach der endgültigen<br />
Auflösung des Klosters, eine besondere<br />
Bedeutung. Er löst dementsprechend<br />
bei vielen Menschen positive Assoziationen<br />
aus – die Anzahl der Busse, die alljährlich<br />
vor dem Kloster in Mittelzell parken,<br />
spricht Bände. 1<br />
Die Klosterbauten selbst sind ein gewichtiger,<br />
jedoch nur punktuell faßbarer Zeuge<br />
der großen Klostergeschichte und des dazugehörigen<br />
wechselseitigen Zusammenspiels<br />
zwischen den Mönchen und ihrer<br />
unmittelbaren materiellen wie immateriellen<br />
Umwelt. Letztendlich hingegen, so<br />
die These, sollte dieses besondere Wechselspiel<br />
zwischen dem Kloster und „seiner“<br />
Insel in der Kulturlandschaft der gesamten<br />
Reichenau mit besonderer Intensität<br />
in einer zu Landschaft gewordenen<br />
Gegenständlichkeit manifest werden.<br />
Historische Strukturen im Landschaftsbild<br />
Damit stellen sich die Fragen, wo und in<br />
welcher Form die einzigartige Geschichte<br />
der Klosterinsel Reichenau im heutigen<br />
Landschaftsbild greifbar wird? Welche<br />
Spuren, Strukturen und materielle Substanz<br />
der jahrhundertelangen Auseinandersetzung<br />
der Mönche, Fischer und Bauern<br />
mit ihrer Umwelt sind im heutigen<br />
Erscheinungsbild der Insel noch manifest?<br />
Hat sich das historische Raumgefüge<br />
als Ganzes, in Teilen, kaum oder überhaupt<br />
nicht erhalten? Inwieweit ist der<br />
aus der Geschichte ererbte Bauplan der<br />
Landschaft auch im ausgehenden 20.<br />
Jahrhundert nachvollziehbar?<br />
Anhand dieser Leitfragen soll im folgenden<br />
das Werden und Sein der Kulturlandschaft<br />
der Insel Reichenau in ihren Grundzügen<br />
für das 18. bis 20. Jahrhundert analysiert<br />
und im Anschluß bewertet werden.<br />
Die aufgelisteten Fragen machen zudem<br />
deutlich, daß in einer landschaftlichen<br />
Betrachtungsperspektive erst das Zusammenwirken<br />
von Substanz und Struktur<br />
über die „historische Wertigkeit“ einer<br />
Kulturlandschaft entscheidet. Eine aus historisch-geographischer<br />
Sicht erarbeitete<br />
Bewertung muß daher primär danach fragen,<br />
inwieweit die Geschichte insbesondere<br />
in Form von Strukturen und darüber<br />
hinaus in Form von materiellen Spuren in<br />
der Landschaft noch ablesbar ist. Im Zentrum<br />
der in dieser Studie vorgelegten Bewertung<br />
steht damit der historische Zeugniswert<br />
der in der Reichenaulandschaft<br />
erkennbaren, aus der Geschichte ererbten<br />
Strukturen. Die Bewertung der materiellen<br />
Substanz, insbesondere der baulichen Substanz<br />
der Kirchen und anderer Gebäude,<br />
ist demgegenüber nicht primär Aufgabe<br />
der historischen Geographie, sondern<br />
wird der Baudenkmalpflege und der Bodendenkmalpflege<br />
überlassen. Die in der<br />
1 Historische Gebäude wie Klöster oder Kirchen<br />
ebenso wie archäologische Stätten und<br />
historisch gewordene Kulturlandschaften<br />
sind nicht einfach nur „Dinge an sich“, sondern<br />
mit ihnen verbinden sich werthaltige<br />
Bilder. Aus einer semiotisch ausgerichteten<br />
Perspektive werden diese Gebäude, Stätten<br />
und Landschaften zu einem Reservoir an materiellen<br />
Zeichen. Je nach historischem und<br />
individuellem Kontext werden letztere jedoch<br />
unterschiedlich wahrgenommen und<br />
erhalten dadurch verschiedene ideelle Wertigkeiten<br />
zugesprochen.<br />
Enclosure A 10<br />
7