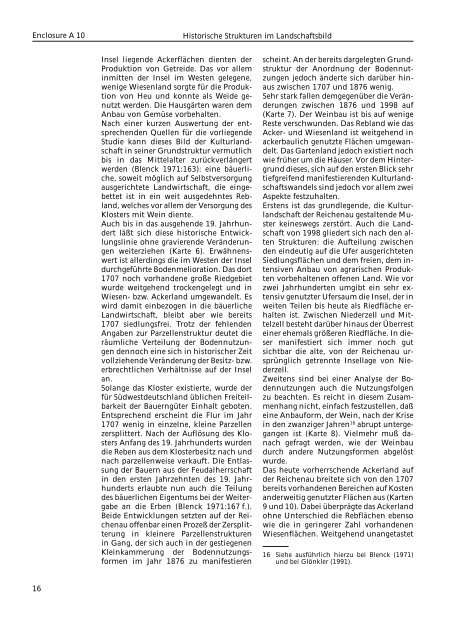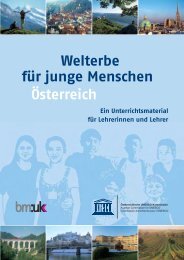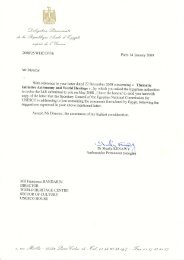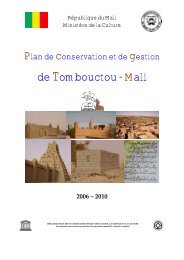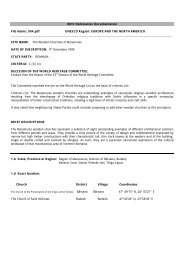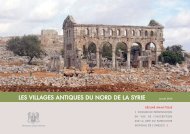Monastic Island of Reicheneau - UNESCO: World Heritage
Monastic Island of Reicheneau - UNESCO: World Heritage
Monastic Island of Reicheneau - UNESCO: World Heritage
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Enclosure A 10 Historische Strukturen im Landschaftsbild<br />
16<br />
Insel liegende Ackerflächen dienten der<br />
Produktion von Getreide. Das vor allem<br />
inmitten der Insel im Westen gelegene,<br />
wenige Wiesenland sorgte für die Produktion<br />
von Heu und konnte als Weide genutzt<br />
werden. Die Hausgärten waren dem<br />
Anbau von Gemüse vorbehalten.<br />
Nach einer kurzen Auswertung der entsprechenden<br />
Quellen für die vorliegende<br />
Studie kann dieses Bild der Kulturlandschaft<br />
in seiner Grundstruktur vermutlich<br />
bis in das Mittelalter zurückverlängert<br />
werden (Blenck 1971:163): eine bäuerliche,<br />
soweit möglich auf Selbstversorgung<br />
ausgerichtete Landwirtschaft, die eingebettet<br />
ist in ein weit ausgedehntes Rebland,<br />
welches vor allem der Versorgung des<br />
Klosters mit Wein diente.<br />
Auch bis in das ausgehende 19. Jahrhundert<br />
läßt sich diese historische Entwicklungslinie<br />
ohne gravierende Veränderungen<br />
weiterziehen (Karte 6). Erwähnenswert<br />
ist allerdings die im Westen der Insel<br />
durchgeführte Bodenmelioration. Das dort<br />
1707 noch vorhandene große Riedgebiet<br />
wurde weitgehend trockengelegt und in<br />
Wiesen- bzw. Ackerland umgewandelt. Es<br />
wird damit einbezogen in die bäuerliche<br />
Landwirtschaft, bleibt aber wie bereits<br />
1707 siedlungsfrei. Trotz der fehlenden<br />
Angaben zur Parzellenstruktur deutet die<br />
räumliche Verteilung der Bodennutzungen<br />
dennoch eine sich in historischer Zeit<br />
vollziehende Veränderung der Besitz- bzw.<br />
erbrechtlichen Verhältnisse auf der Insel<br />
an.<br />
Solange das Kloster existierte, wurde der<br />
für Südwestdeutschland üblichen Freiteilbarkeit<br />
der Bauerngüter Einhalt geboten.<br />
Entsprechend erscheint die Flur im Jahr<br />
1707 wenig in einzelne, kleine Parzellen<br />
zersplittert. Nach der Auflösung des Klosters<br />
Anfang des 19. Jahrhunderts wurden<br />
die Reben aus dem Klosterbesitz nach und<br />
nach parzellenweise verkauft. Die Entlassung<br />
der Bauern aus der Feudalherrschaft<br />
in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts<br />
erlaubte nun auch die Teilung<br />
des bäuerlichen Eigentums bei der Weitergabe<br />
an die Erben (Blenck 1971:167 f.).<br />
Beide Entwicklungen setzten auf der Reichenau<br />
<strong>of</strong>fenbar einen Prozeß der Zersplitterung<br />
in kleinere Parzellenstrukturen<br />
in Gang, der sich auch in der gestiegenen<br />
Kleinkammerung der Bodennutzungsformen<br />
im Jahr 1876 zu manifestieren<br />
scheint. An der bereits dargelegten Grundstruktur<br />
der Anordnung der Bodennutzungen<br />
jedoch änderte sich darüber hinaus<br />
zwischen 1707 und 1876 wenig.<br />
Sehr stark fallen demgegenüber die Veränderungen<br />
zwischen 1876 und 1998 auf<br />
(Karte 7). Der Weinbau ist bis auf wenige<br />
Reste verschwunden. Das Rebland wie das<br />
Acker- und Wiesenland ist weitgehend in<br />
ackerbaulich genutzte Flächen umgewandelt.<br />
Das Gartenland jedoch existiert noch<br />
wie früher um die Häuser. Vor dem Hintergrund<br />
dieses, sich auf den ersten Blick sehr<br />
tiefgreifend manifestierenden Kulturlandschaftswandels<br />
sind jedoch vor allem zwei<br />
Aspekte festzuhalten.<br />
Erstens ist das grundlegende, die Kulturlandschaft<br />
der Reichenau gestaltende Muster<br />
keineswegs zerstört. Auch die Landschaft<br />
von 1998 gliedert sich nach den alten<br />
Strukturen: die Aufteilung zwischen<br />
den eindeutig auf die Ufer ausgerichteten<br />
Siedlungsflächen und dem freien, dem intensiven<br />
Anbau von agrarischen Produkten<br />
vorbehaltenen <strong>of</strong>fenen Land. Wie vor<br />
zwei Jahrhunderten umgibt ein sehr extensiv<br />
genutzter Ufersaum die Insel, der in<br />
weiten Teilen bis heute als Riedfläche erhalten<br />
ist. Zwischen Niederzell und Mittelzell<br />
besteht darüber hinaus der Überrest<br />
einer ehemals größeren Riedfläche. In dieser<br />
manifestiert sich immer noch gut<br />
sichtbar die alte, von der Reichenau ursprünglich<br />
getrennte Insellage von Niederzell.<br />
Zweitens sind bei einer Analyse der Bodennutzungen<br />
auch die Nutzungsfolgen<br />
zu beachten. Es reicht in diesem Zusammenhang<br />
nicht, einfach festzustellen, daß<br />
eine Anbauform, der Wein, nach der Krise<br />
in den zwanziger Jahren 16 abrupt untergegangen<br />
ist (Karte 8). Vielmehr muß danach<br />
gefragt werden, wie der Weinbau<br />
durch andere Nutzungsformen abgelöst<br />
wurde.<br />
Das heute vorherrschende Ackerland auf<br />
der Reichenau breitete sich von den 1707<br />
bereits vorhandenen Bereichen auf Kosten<br />
anderweitig genutzter Flächen aus (Karten<br />
9 und 10). Dabei überprägte das Ackerland<br />
ohne Unterschied die Rebflächen ebenso<br />
wie die in geringerer Zahl vorhandenen<br />
Wiesenflächen. Weitgehend unangetastet<br />
16 Siehe ausführlich hierzu bei Blenck (1971)<br />
und bei Glönkler (1991).