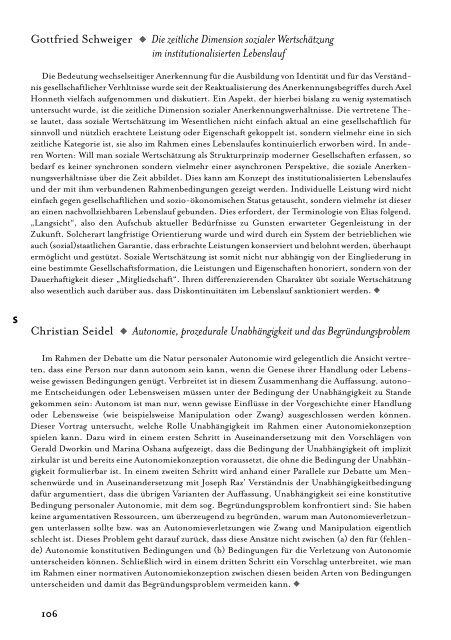Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
S<br />
Gottfried Schweiger ◆ Die zeitliche Dimension sozialer Wertschätzung<br />
im institutionalisierten Lebenslauf<br />
Die Bedeutung wechselseitiger Anerkennung <strong>für</strong> die Ausbildung von Identität und <strong>für</strong> das Verständnis<br />
gesellschaftlicher Verhltnisse wurde seit der Reaktualisierung des Anerkennungsbegriffes durch Axel<br />
Honneth vielfach aufgenommen und diskutiert. Ein Aspekt, der hierbei bislang zu wenig systematisch<br />
untersucht wurde, ist die zeitliche Dimension sozialer Anerkennungsverhältnisse. Die vertretene These<br />
lautet, dass soziale Wertschätzung im Wesentlichen nicht einfach aktual an eine gesellschaftlich <strong>für</strong><br />
sinnvoll und nützlich erachtete Leistung oder Eigenschaft gekoppelt ist, sondern vielmehr eine in sich<br />
zeitliche Kategorie ist, sie also im Rahmen eines Lebenslaufes kontinuierlich erworben wird. In anderen<br />
Worten: Will man soziale Wertschätzung als Strukturprinzip moderner <strong>Gesellschaft</strong>en erfassen, so<br />
bedarf es keiner synchronen sondern vielmehr einer asynchronen Perspektive, die soziale Anerkennungsverhältnisse<br />
über die Zeit abbildet. Dies kann am Konzept des institutionalisierten Lebenslaufes<br />
und der mit ihm verbundenen Rahmenbedingungen gezeigt werden. Individuelle Leistung wird nicht<br />
einfach gegen gesellschaftlichen und sozio-ökonomischen Status getauscht, sondern vielmehr ist dieser<br />
an einen nachvollziehbaren Lebenslauf gebunden. Dies erfordert, der Terminologie von Elias folgend,<br />
„Langsicht“, also den Aufschub aktueller Bedürfnisse zu Gunsten erwarteter Gegenleistung in der<br />
Zukunft. Solcherart langfristige Orientierung wurde und wird durch ein System der betrieblichen wie<br />
auch (sozial)staatlichen Garantie, dass erbrachte Leistungen konserviert und belohnt werden, überhaupt<br />
ermöglicht und gestützt. Soziale Wertschätzung ist somit nicht nur abhängig von der Eingliederung in<br />
eine bestimmte <strong>Gesellschaft</strong>sformation, die Leistungen und Eigenschaften honoriert, sondern von der<br />
Dauerhaftigkeit dieser „Mitgliedschaft“. Ihren differenzierenden Charakter übt soziale Wertschätzung<br />
also wesentlich auch darüber aus, dass Diskontinuitäten im Lebenslauf sanktioniert werden. ◆<br />
Christian Seidel ◆ Autonomie, prozedurale Unabhängigkeit und das Begründungsproblem<br />
Im Rahmen der Debatte um die Natur personaler Autonomie wird gelegentlich die Ansicht vertreten,<br />
dass eine Person nur dann autonom sein kann, wenn die Genese ihrer Handlung oder Lebensweise<br />
gewissen Bedingungen genügt. Verbreitet ist in diesem Zusammenhang die Auffassung, autonome<br />
Entscheidungen oder Lebensweisen müssen unter der Bedingung der Unabhängigkeit zu Stande<br />
gekommen sein: Autonom ist man nur, wenn gewisse Einflüsse in der Vorgeschichte einer Handlung<br />
oder Lebensweise (wie beispielsweise Manipulation oder Zwang) ausgeschlossen werden können.<br />
Dieser Vortrag untersucht, welche Rolle Unabhängigkeit im Rahmen einer Autonomiekonzeption<br />
spielen kann. Dazu wird in einem ersten Schritt in Auseinandersetzung mit den Vorschlägen von<br />
Gerald Dworkin und Marina Oshana aufgezeigt, dass die Bedingung der Unabhängigkeit oft implizit<br />
zirkulär ist und bereits eine Autonomiekonzeption voraussetzt, die ohne die Bedingung der Unabhängigkeit<br />
formulierbar ist. In einem zweiten Schritt wird anhand einer Parallele zur Debatte um Menschenwürde<br />
und in Auseinandersetzung mit Joseph Raz’ Verständnis der Unabhängigkeitbedingung<br />
da<strong>für</strong> argumentiert, dass die übrigen Varianten der Auffassung, Unabhängigkeit sei eine konstitutive<br />
Bedingung personaler Autonomie, mit dem sog. Begründungsproblem konfrontiert sind: Sie haben<br />
keine argumentativen Ressourcen, um überzeugend zu begründen, warum man Autonomieverletzungen<br />
unterlassen sollte bzw. was an Autonomieverletzungen wie Zwang und Manipulation eigentlich<br />
schlecht ist. Dieses Problem geht darauf zurück, dass diese Ansätze nicht zwischen (a) den <strong>für</strong> (fehlende)<br />
Autonomie konstitutiven Bedingungen und (b) Bedingungen <strong>für</strong> die Verletzung von Autonomie<br />
unterscheiden können. Schließlich wird in einem dritten Schritt ein Vorschlag unterbreitet, wie man<br />
im Rahmen einer normativen Autonomiekonzeption zwischen diesen beiden Arten von Bedingungen<br />
unterscheiden und damit das Begründungsproblem vermeiden kann. ◆<br />
106