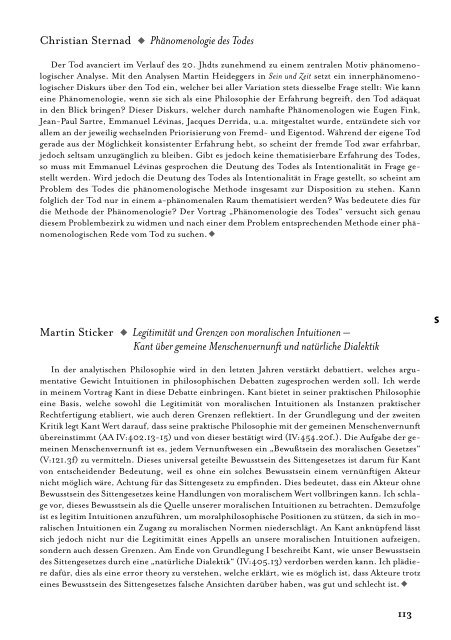Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Christian Sternad ◆ Phänomenologie des Todes<br />
Der Tod avanciert im Verlauf des 20. Jhdts zunehmend zu einem zentralen Motiv phänomenologischer<br />
Analyse. Mit den Analysen Martin Heideggers in Sein und Zeit setzt ein innerphänomenologischer<br />
Diskurs über den Tod ein, welcher bei aller Variation stets diesselbe Frage stellt: Wie kann<br />
eine Phänomenologie, wenn sie sich als eine Philosophie der Erfahrung begreift, den Tod adäquat<br />
in den Blick bringen? Dieser Diskurs, welcher durch namhafte Phänomenologen wie Eugen Fink,<br />
Jean-Paul Sartre, Emmanuel Lévinas, Jacques Derrida, u.a. mitgestaltet wurde, entzündete sich vor<br />
allem an der jeweilig wechselnden Priorisierung von Fremd- und Eigentod. Während der eigene Tod<br />
gerade aus der Möglichkeit konsistenter Erfahrung hebt, so scheint der fremde Tod zwar erfahrbar,<br />
jedoch seltsam unzugänglich zu bleiben. Gibt es jedoch keine thematisierbare Erfahrung des Todes,<br />
so muss mit Emmanuel Lévinas gesprochen die Deutung des Todes als Intentionalität in Frage gestellt<br />
werden. Wird jedoch die Deutung des Todes als Intentionalität in Frage gestellt, so scheint am<br />
Problem des Todes die phänomenologische Methode insgesamt zur Disposition zu stehen. Kann<br />
folglich der Tod nur in einem a-phänomenalen Raum thematisiert werden? Was bedeutete dies <strong>für</strong><br />
die Methode der Phänomenologie? Der Vortrag „Phänomenologie des Todes“ versucht sich genau<br />
diesem Problembezirk zu widmen und nach einer dem Problem entsprechenden Methode einer phänomenologischen<br />
Rede vom Tod zu suchen. ◆<br />
Martin Sticker ◆ Legitimität und Grenzen von moralischen Intuitionen –<br />
Kant über gemeine Menschenvernunft und natürliche Dialektik<br />
In der analytischen Philosophie wird in den letzten Jahren verstärkt debattiert, welches argumentative<br />
Gewicht Intuitionen in philosophischen Debatten zugesprochen werden soll. Ich werde<br />
in meinem Vortrag Kant in diese Debatte einbringen. Kant bietet in seiner praktischen Philosophie<br />
eine Basis, welche sowohl die Legitimität von moralischen Intuitionen als Instanzen praktischer<br />
Rechtfertigung etabliert, wie auch deren Grenzen reflektiert. In der Grundlegung und der zweiten<br />
Kritik legt Kant Wert darauf, dass seine praktische Philosophie mit der gemeinen Menschenvernunft<br />
übereinstimmt (AA IV:402.13-15) und von dieser bestätigt wird (IV:454.20f.). Die Aufgabe der gemeinen<br />
Menschenvernunft ist es, jedem Vernunftwesen ein „Bewußtsein des moralischen Gesetzes“<br />
(V:121.3f) zu vermitteln. Dieses universal geteilte Bewusstsein des Sittengesetzes ist darum <strong>für</strong> Kant<br />
von entscheidender Bedeutung, weil es ohne ein solches Bewusstsein einem vernünftigen Akteur<br />
nicht möglich wäre, Achtung <strong>für</strong> das Sittengesetz zu empfinden. Dies bedeutet, dass ein Akteur ohne<br />
Bewusstsein des Sittengesetzes keine Handlungen von moralischem Wert vollbringen kann. Ich schlage<br />
vor, dieses Bewusstsein als die Quelle unserer moralischen Intuitionen zu betrachten. Demzufolge<br />
ist es legitim Intuitionen anzuführen, um moralphilosophische Positionen zu stützen, da sich in moralischen<br />
Intuitionen ein Zugang zu moralischen Normen niederschlägt. An Kant anknüpfend lässt<br />
sich jedoch nicht nur die Legitimität eines Appells an unsere moralischen Intuitionen aufzeigen,<br />
sondern auch dessen Grenzen. Am Ende von Grundlegung I beschreibt Kant, wie unser Bewusstsein<br />
des Sittengesetzes durch eine „natürliche Dialektik“ (IV:405.13) verdorben werden kann. Ich plädiere<br />
da<strong>für</strong>, dies als eine error theory zu verstehen, welche erklärt, wie es möglich ist, dass Akteure trotz<br />
eines Bewusstsein des Sittengesetzes falsche Ansichten darüber haben, was gut und schlecht ist. ◆<br />
113<br />
S