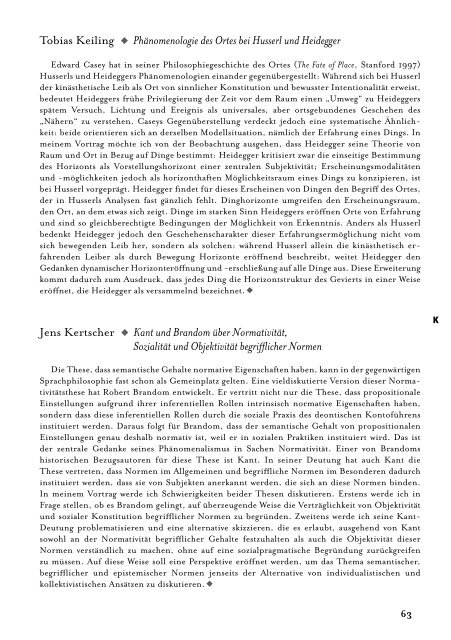Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Tobias Keiling ◆ Phänomenologie des Ortes bei Husserl und Heidegger<br />
Edward Casey hat in seiner Philosophiegeschichte des Ortes (The Fate of Place, Stanford 1997)<br />
Husserls und Heideggers Phänomenologien einander gegenübergestellt: Während sich bei Husserl<br />
der kinästhetische Leib als Ort von sinnlicher Konstitution und bewusster Intentionalität erweist,<br />
bedeutet Heideggers frühe Privilegierung der Zeit vor dem Raum einen „Umweg“ zu Heideggers<br />
spätem Versuch, Lichtung und Ereignis als universales, aber ortsgebundenes Geschehen des<br />
„Nähern“ zu verstehen. Caseys Gegenüberstellung verdeckt jedoch eine systematische Ähnlichkeit:<br />
beide orientieren sich an derselben Modellsituation, nämlich der Erfahrung eines Dings. In<br />
meinem Vortrag möchte ich von der Beobachtung ausgehen, dass Heidegger seine Theorie von<br />
Raum und Ort in Bezug auf Dinge bestimmt: Heidegger kritisiert zwar die einseitige Bestimmung<br />
des Horizonts als Vorstellungshorizont einer zentralen Subjektivität; Erscheinungsmodalitäten<br />
und -möglichkeiten jedoch als horizonthaften Möglichkeitsraum eines Dings zu konzipieren, ist<br />
bei Husserl vorgeprägt. Heidegger findet <strong>für</strong> dieses Erscheinen von Dingen den Begriff des Ortes,<br />
der in Husserls Analysen fast gänzlich fehlt. Dinghorizonte umgreifen den Erscheinungsraum,<br />
den Ort, an dem etwas sich zeigt. Dinge im starken Sinn Heideggers eröffnen Orte von Erfahrung<br />
und sind so gleichberechtigte Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis. Anders als Husserl<br />
bedenkt Heidegger jedoch den Geschehenscharakter dieser Erfahrungsermöglichung nicht vom<br />
sich bewegenden Leib her, sondern als solchen: während Husserl allein die kinästhetisch erfahrenden<br />
Leiber als durch Bewegung Horizonte eröffnend beschreibt, weitet Heidegger den<br />
Gedanken dynamischer Horizonteröffnung und -erschließung auf alle Dinge aus. Diese Erweiterung<br />
kommt dadurch zum Ausdruck, dass jedes Ding die Horizontstruktur des Gevierts in einer Weise<br />
eröffnet, die Heidegger als versammelnd bezeichnet. ◆<br />
Jens Kertscher ◆ Kant und Brandom über Normativität,<br />
Sozialität und Objektivität begrifflicher Normen<br />
Die These, dass semantische Gehalte normative Eigenschaften haben, kann in der gegenwärtigen<br />
Sprachphilosophie fast schon als Gemeinplatz gelten. Eine vieldiskutierte Version dieser Normativitätsthese<br />
hat Robert Brandom entwickelt. Er vertritt nicht nur die These, dass propositionale<br />
Einstellungen aufgrund ihrer inferentiellen Rollen intrinsisch normative Eigenschaften haben,<br />
sondern dass diese inferentiellen Rollen durch die soziale Praxis des deontischen Kontoführens<br />
instituiert werden. Daraus folgt <strong>für</strong> Brandom, dass der semantische Gehalt von propositionalen<br />
Einstellungen genau deshalb normativ ist, weil er in sozialen Praktiken instituiert wird. Das ist<br />
der zentrale Gedanke seines Phänomenalismus in Sachen Normativität. Einer von Brandoms<br />
historischen Bezugsautoren <strong>für</strong> diese These ist Kant. In seiner Deutung hat auch Kant die<br />
These vertreten, dass Normen im Allgemeinen und begriffliche Normen im Besonderen dadurch<br />
instituiert werden, dass sie von Subjekten anerkannt werden, die sich an diese Normen binden.<br />
In meinem Vortrag werde ich Schwierigkeiten beider Thesen diskutieren. Erstens werde ich in<br />
Frage stellen, ob es Brandom gelingt, auf überzeugende Weise die Verträglichkeit von Objektivität<br />
und sozialer Konstitution begrifflicher Normen zu begründen. Zweitens werde ich seine Kant-<br />
Deutung problematisieren und eine alternative skizzieren, die es erlaubt, ausgehend von Kant<br />
sowohl an der Normativität begrifflicher Gehalte festzuhalten als auch die Objektivität dieser<br />
Normen verständlich zu machen, ohne auf eine sozialpragmatische Begründung zurückgreifen<br />
zu müssen. Auf diese Weise soll eine Perspektive eröffnet werden, um das Thema semantischer,<br />
begrifflicher und epistemischer Normen jenseits der Alternative von individualistischen und<br />
kollektivistischen Ansätzen zu diskutieren. ◆<br />
63<br />
K