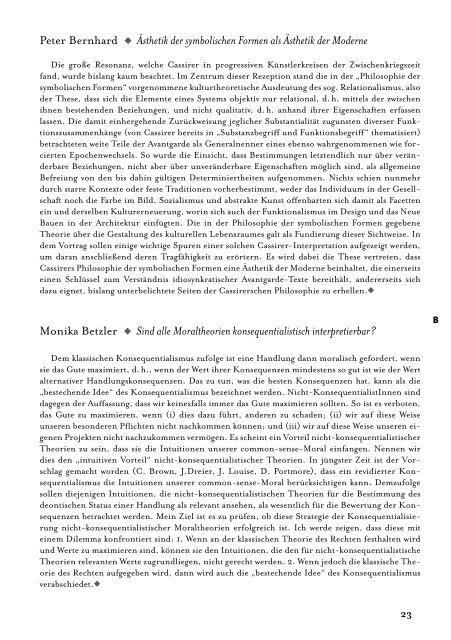Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Peter Bernhard ◆ Ästhetik der symbolischen Formen als Ästhetik der Moderne<br />
Die große Resonanz, welche Cassirer in progressiven Künstlerkreisen der Zwischenkriegszeit<br />
fand, wurde bislang kaum beachtet. Im Zentrum dieser Rezeption stand die in der „Philosophie der<br />
symbolischen Formen“ vorgenommene kulturtheoretische Ausdeutung des sog. Relationalismus, also<br />
der These, dass sich die Elemente eines Systems objektiv nur relational, d. h. mittels der zwischen<br />
ihnen bestehenden Beziehungen, und nicht qualitativ, d. h. anhand ihrer Eigenschaften erfassen<br />
lassen. Die damit einhergehende Zurückweisung jeglicher Substantialität zugunsten diverser Funktionszusammenhänge<br />
(von Cassirer bereits in „Substanzbegriff und Funktionsbegriff“ thematisiert)<br />
betrachteten weite Teile der Avantgarde als Generalnenner eines ebenso wahrgenommenen wie forcierten<br />
Epochenwechsels. So wurde die Einsicht, dass Bestimmungen letztendlich nur über veränderbare<br />
Beziehungen, nicht aber über unveränderbare Eigenschaften möglich sind, als allgemeine<br />
Befreiung von den bis dahin gültigen Determiniertheiten aufgenommen. Nichts schien nunmehr<br />
durch starre Kontexte oder feste Traditionen vorherbestimmt, weder das Individuum in der <strong>Gesellschaft</strong><br />
noch die Farbe im Bild. Sozialismus und abstrakte Kunst offenbarten sich damit als Facetten<br />
ein und derselben Kulturerneuerung, worin sich auch der Funktionalismus im Design und das Neue<br />
Bauen in der Architektur einfügten. Die in der Philosophie der symbolischen Formen gegebene<br />
Theorie über die Gestaltung des kulturellen Lebensraumes galt als Fundierung dieser Sichtweise. In<br />
dem Vortrag sollen einige wichtige Spuren einer solchen Cassirer-Interpretation aufgezeigt werden,<br />
um daran anschließend deren Tragfähigkeit zu erörtern. Es wird dabei die These vertreten, dass<br />
Cassirers Philosophie der symbolischen Formen eine Ästhetik der Moderne beinhaltet, die einerseits<br />
einen Schlüssel zum Verständnis idiosynkratischer Avantgarde-Texte bereithält, andererseits sich<br />
dazu eignet, bislang unterbelichtete Seiten der Cassirerschen Philosophie zu erhellen.◆<br />
Monika Betzler ◆ Sind alle Moraltheorien konsequentialistisch interpretierbar?<br />
Dem klassischen Konsequentialismus zufolge ist eine Handlung dann moralisch gefordert, wenn<br />
sie das Gute maximiert, d. h., wenn der Wert ihrer Konsequenzen mindestens so gut ist wie der Wert<br />
alternativer Handlungskonsequenzen. Das zu tun, was die besten Konsequenzen hat, kann als die<br />
„bestechende Idee“ des Konsequentialismus bezeichnet werden. Nicht-KonsequentialistInnen sind<br />
dagegen der Auffassung, dass wir keinesfalls immer das Gute maximieren sollten. So ist es verboten,<br />
das Gute zu maximieren, wenn (i) dies dazu führt, anderen zu schaden; (ii) wir auf diese Weise<br />
unseren besonderen Pflichten nicht nachkommen können; und (iii) wir auf diese Weise unseren eigenen<br />
Projekten nicht nachzukommen vermögen. Es scheint ein Vorteil nicht-konsequentialistischer<br />
Theorien zu sein, dass sie die Intuitionen unserer common-sense-Moral einfangen. Nennen wir<br />
dies den „intuitiven Vorteil“ nicht-konsequentialistischer Theorien. In jüngster Zeit ist der Vorschlag<br />
gemacht worden (C. Brown, J.Dreier, J. Louise, D. Portmore), dass ein revidierter Konsequentialismus<br />
die Intuitionen unserer common-sense-Moral berücksichtigen kann. Demzufolge<br />
sollen diejenigen Intuitionen, die nicht-konsequentialistischen Theorien <strong>für</strong> die Bestimmung des<br />
deontischen Status einer Handlung als relevant ansehen, als wesentlich <strong>für</strong> die Bewertung der Konsequenzen<br />
betrachtet werden. Mein Ziel ist es zu prüfen, ob diese Strategie der Konsequentialisierung<br />
nicht-konsequentialistischer Moraltheorien erfolgreich ist. Ich werde zeigen, dass diese mit<br />
einem Dilemma konfrontiert sind: 1. Wenn an der klassischen Theorie des Rechten festhalten wird<br />
und Werte zu maximieren sind, können sie den Intuitionen, die den <strong>für</strong> nicht-konsequentialistische<br />
Theorien relevanten Werte zugrundliegen, nicht gerecht werden. 2. Wenn jedoch die klassische Theorie<br />
des Rechten aufgegeben wird, dann wird auch die „bestechende Idee“ des Konsequentialismus<br />
verabschiedet.◆<br />
23<br />
B