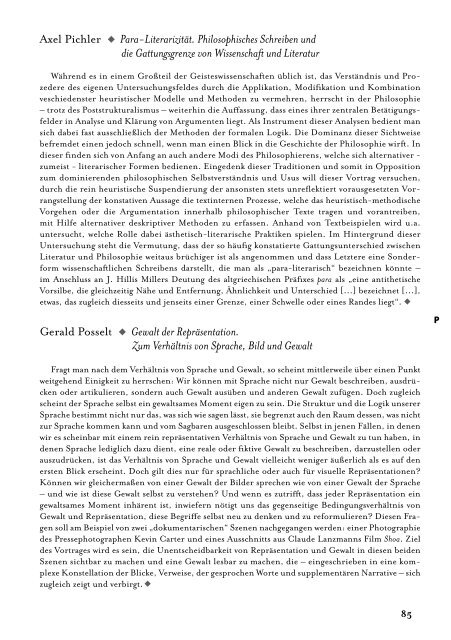Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Axel Pichler ◆ Para-Literarizität. Philosophisches Schreiben und<br />
die Gattungsgrenze von Wissenschaft und Literatur<br />
Während es in einem Großteil der Geisteswissenschaften üblich ist, das Verständnis und Prozedere<br />
des eigenen Untersuchungsfeldes durch die Applikation, Modifikation und Kombination<br />
veschiedenster heuristischer Modelle und Methoden zu vermehren, herrscht in der Philosophie<br />
– trotz des Poststrukturalismus – weiterhin die Auffassung, dass eines ihrer zentralen Betätigungsfelder<br />
in Analyse und Klärung von Argumenten liegt. Als Instrument dieser Analysen bedient man<br />
sich dabei fast ausschließlich der Methoden der formalen Logik. Die Dominanz dieser Sichtweise<br />
befremdet einen jedoch schnell, wenn man einen Blick in die Geschichte der Philosophie wirft. In<br />
dieser finden sich von Anfang an auch andere Modi des Philosophierens, welche sich alternativer -<br />
zumeist - literarischer Formen bedienen. Eingedenk dieser Traditionen und somit in Opposition<br />
zum dominierenden philosophischen Selbstverständnis und Usus will dieser Vortrag versuchen,<br />
durch die rein heuristische Suspendierung der ansonsten stets unreflektiert vorausgesetzten Vorrangstellung<br />
der konstativen Aussage die textinternen Prozesse, welche das heuristisch-methodische<br />
Vorgehen oder die Argumentation innerhalb philosophischer Texte tragen und vorantreiben,<br />
mit Hilfe alternativer deskriptiver Methoden zu erfassen. Anhand von Textbeispielen wird u.a.<br />
untersucht, welche Rolle dabei ästhetisch-literarische Praktiken spielen. Im Hintergrund dieser<br />
Untersuchung steht die Vermutung, dass der so häufig konstatierte Gattungsunterschied zwischen<br />
Literatur und Philosophie weitaus brüchiger ist als angenommen und dass Letztere eine Sonderform<br />
wissenschaftlichen Schreibens darstellt, die man als „para-literarisch“ bezeichnen könnte –<br />
im Anschluss an J. Hillis Millers Deutung des altgriechischen Präfixes para als „eine antithetische<br />
Vorsilbe, die gleichzeitig Nähe und Entfernung, Ähnlichkeit und Unterschied [...] bezeichnet [...],<br />
etwas, das zugleich diesseits und jenseits einer Grenze, einer Schwelle oder eines Randes liegt“. ◆<br />
Gerald Posselt ◆ Gewalt der Repräsentation.<br />
Zum Verhältnis von Sprache, Bild und Gewalt<br />
Fragt man nach dem Verhältnis von Sprache und Gewalt, so scheint mittlerweile über einen Punkt<br />
weitgehend Einigkeit zu herrschen: Wir können mit Sprache nicht nur Gewalt beschreiben, ausdrücken<br />
oder artikulieren, sondern auch Gewalt ausüben und anderen Gewalt zufügen. Doch zugleich<br />
scheint der Sprache selbst ein gewaltsames Moment eigen zu sein. Die Struktur und die Logik unserer<br />
Sprache bestimmt nicht nur das, was sich wie sagen lässt, sie begrenzt auch den Raum dessen, was nicht<br />
zur Sprache kommen kann und vom Sagbaren ausgeschlossen bleibt. Selbst in jenen Fällen, in denen<br />
wir es scheinbar mit einem rein repräsentativen Verhältnis von Sprache und Gewalt zu tun haben, in<br />
denen Sprache lediglich dazu dient, eine reale oder fiktive Gewalt zu beschreiben, darzustellen oder<br />
auszudrücken, ist das Verhältnis von Sprache und Gewalt vielleicht weniger äußerlich als es auf den<br />
ersten Blick erscheint. Doch gilt dies nur <strong>für</strong> sprachliche oder auch <strong>für</strong> visuelle Repräsentationen?<br />
Können wir gleichermaßen von einer Gewalt der Bilder sprechen wie von einer Gewalt der Sprache<br />
– und wie ist diese Gewalt selbst zu verstehen? Und wenn es zutrifft, dass jeder Repräsentation ein<br />
gewaltsames Moment inhärent ist, inwiefern nötigt uns das gegenseitige Bedingungsverhältnis von<br />
Gewalt und Repräsentation, diese Begriffe selbst neu zu denken und zu reformulieren? Diesen Fragen<br />
soll am Beispiel von zwei „dokumentarischen“ Szenen nachgegangen werden: einer Photographie<br />
des Pressephotographen Kevin Carter und eines Ausschnitts aus Claude Lanzmanns Film Shoa. Ziel<br />
des Vortrages wird es sein, die Unentscheidbarkeit von Repräsentation und Gewalt in diesen beiden<br />
Szenen sichtbar zu machen und eine Gewalt lesbar zu machen, die – eingeschrieben in eine komplexe<br />
Konstellation der Blicke, Verweise, der gesprochen Worte und supplementären Narrative – sich<br />
zugleich zeigt und verbirgt. ◆<br />
85<br />
P