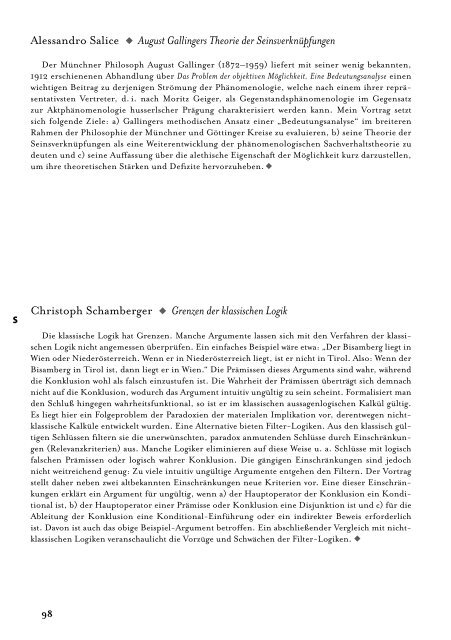Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
S<br />
Alessandro Salice ◆ August Gallingers Theorie der Seinsverknüpfungen<br />
Der Münchner Philosoph August Gallinger (1872–1959) liefert mit seiner wenig bekannten,<br />
1912 erschienenen Abhandlung über Das Problem der objektiven Möglichkeit. Eine Bedeutungsanalyse einen<br />
wichtigen Beitrag zu derjenigen Strömung der Phänomenologie, welche nach einem ihrer repräsentativsten<br />
Vertreter, d. i. nach Moritz Geiger, als Gegenstandsphänomenologie im Gegensatz<br />
zur Aktphänomenologie husserlscher Prägung charakterisiert werden kann. Mein Vortrag setzt<br />
sich folgende Ziele: a) Gallingers methodischen Ansatz einer „Bedeutungsanalyse“ im breiteren<br />
Rahmen der Philosophie der Münchner und Göttinger Kreise zu evaluieren, b) seine Theorie der<br />
Seinsverknüpfungen als eine Weiterentwicklung der phänomenologischen Sachverhaltstheorie zu<br />
deuten und c) seine Auffassung über die alethische Eigenschaft der Möglichkeit kurz darzustellen,<br />
um ihre theoretischen Stärken und Defizite hervorzuheben. ◆<br />
Christoph Schamberger ◆ Grenzen der klassischen Logik<br />
Die klassische Logik hat Grenzen. Manche Argumente lassen sich mit den Verfahren der klassischen<br />
Logik nicht angemessen überprüfen. Ein einfaches Beispiel wäre etwa: „Der Bisamberg liegt in<br />
Wien oder Niederösterreich. Wenn er in Niederösterreich liegt, ist er nicht in Tirol. Also: Wenn der<br />
Bisamberg in Tirol ist, dann liegt er in Wien.“ Die Prämissen dieses Arguments sind wahr, während<br />
die Konklusion wohl als falsch einzustufen ist. Die Wahrheit der Prämissen überträgt sich demnach<br />
nicht auf die Konklusion, wodurch das Argument intuitiv ungültig zu sein scheint. Formalisiert man<br />
den Schluß hingegen wahrheitsfunktional, so ist er im klassischen aussagenlogischen Kalkül gültig.<br />
Es liegt hier ein Folgeproblem der Paradoxien der materialen Implikation vor, derentwegen nichtklassische<br />
Kalküle entwickelt wurden. Eine Alternative bieten Filter-Logiken. Aus den klassisch gültigen<br />
Schlüssen filtern sie die unerwünschten, paradox anmutenden Schlüsse durch Einschränkungen<br />
(Relevanzkriterien) aus. Manche Logiker eliminieren auf diese Weise u. a. Schlüsse mit logisch<br />
falschen Prämissen oder logisch wahrer Konklusion. Die gängigen Einschränkungen sind jedoch<br />
nicht weitreichend genug: Zu viele intuitiv ungültige Argumente entgehen den Filtern. Der Vortrag<br />
stellt daher neben zwei altbekannten Einschränkungen neue Kriterien vor. Eine dieser Einschränkungen<br />
erklärt ein Argument <strong>für</strong> ungültig, wenn a) der Hauptoperator der Konklusion ein Konditional<br />
ist, b) der Hauptoperator einer Prämisse oder Konklusion eine Disjunktion ist und c) <strong>für</strong> die<br />
Ableitung der Konklusion eine Konditional-Einführung oder ein indirekter Beweis erforderlich<br />
ist. Davon ist auch das obige Beispiel-Argument betroffen. Ein abschließender Vergleich mit nichtklassischen<br />
Logiken veranschaulicht die Vorzüge und Schwächen der Filter-Logiken. ◆<br />
98