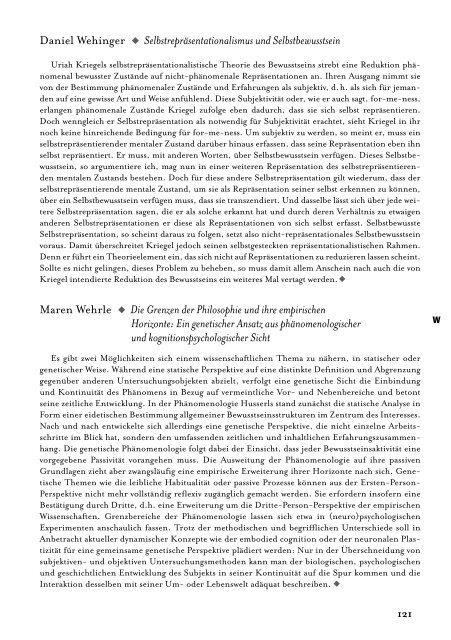Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Daniel Wehinger ◆ Selbstrepräsentationalismus und Selbstbewusstsein<br />
Uriah Kriegels selbstrepräsentationalistische Theorie des Bewusstseins strebt eine Reduktion phänomenal<br />
bewusster Zustände auf nicht-phänomenale Repräsentationen an. Ihren Ausgang nimmt sie<br />
von der Bestimmung phänomenaler Zustände und Erfahrungen als subjektiv, d. h. als sich <strong>für</strong> jemanden<br />
auf eine gewisse Art und Weise anfühlend. Diese Subjektivität oder, wie er auch sagt, for-me-ness,<br />
erlangen phänomenale Zustände Kriegel zufolge eben dadurch, dass sie sich selbst repräsentieren.<br />
Doch wenngleich er Selbstrepräsentation als notwendig <strong>für</strong> Subjektivität erachtet, sieht Kriegel in ihr<br />
noch keine hinreichende Bedingung <strong>für</strong> for-me-ness. Um subjektiv zu werden, so meint er, muss ein<br />
selbstrepräsentierender mentaler Zustand darüber hinaus erfassen, dass seine Repräsentation eben ihn<br />
selbst repräsentiert. Er muss, mit anderen Worten, über Selbstbewusstsein verfügen. Dieses Selbstbewusstsein,<br />
so argumentiere ich, mag nun in einer weiteren Repräsentation des selbstrepräsentierenden<br />
mentalen Zustands bestehen. Doch <strong>für</strong> diese andere Selbstrepräsentation gilt wiederum, dass der<br />
selbstrepräsentierende mentale Zustand, um sie als Repräsentation seiner selbst erkennen zu können,<br />
über ein Selbstbewusstsein verfügen muss, dass sie transzendiert. Und dasselbe lässt sich über jede weitere<br />
Selbstrepräsentation sagen, die er als solche erkannt hat und durch deren Verhältnis zu etwaigen<br />
anderen Selbstrepräsentationen er diese als Repräsentationen von sich selbst erfasst. Selbstbewusste<br />
Selbstrepräsentation, so scheint daraus zu folgen, setzt also nicht-repräsentationales Selbstbewusstsein<br />
voraus. Damit überschreitet Kriegel jedoch seinen selbstgesteckten repräsentationalistischen Rahmen.<br />
Denn er führt ein Theorieelement ein, das sich nicht auf Repräsentationen zu reduzieren lassen scheint.<br />
Sollte es nicht gelingen, dieses Problem zu beheben, so muss damit allem Anschein nach auch die von<br />
Kriegel intendierte Reduktion des Bewusstseins ein weiteres Mal vertagt werden. ◆<br />
Maren Wehrle ◆ Die Grenzen der Philosophie und ihre empirischen<br />
Horizonte: Ein genetischer Ansatz aus phänomenologischer<br />
und kognitionspsychologischer Sicht<br />
Es gibt zwei Möglichkeiten sich einem wissenschaftlichen Thema zu nähern, in statischer oder<br />
genetischer Weise. Während eine statische Perspektive auf eine distinkte Definition und Abgrenzung<br />
gegenüber anderen Untersuchungsobjekten abzielt, verfolgt eine genetische Sicht die Einbindung<br />
und Kontinuität des Phänomens in Bezug auf vermeintliche Vor- und Nebenbereiche und betont<br />
seine zeitliche Entwicklung. In der Phänomenologie Husserls stand zunächst die statische Analyse in<br />
Form einer eidetischen Bestimmung allgemeiner Bewusstseinsstrukturen im Zentrum des Interesses.<br />
Nach und nach entwickelte sich allerdings eine genetische Perspektive, die nicht einzelne Arbeitsschritte<br />
im Blick hat, sondern den umfassenden zeitlichen und inhaltlichen Erfahrungszusammenhang.<br />
Die genetische Phänomenologie folgt dabei der Einsicht, dass jeder Bewusstseinsaktivität eine<br />
vorgegebene Passivität vorangehen muss. Die Ausweitung der Phänomenologie auf ihre passiven<br />
Grundlagen zieht aber zwangsläufig eine empirische Erweiterung ihrer Horizonte nach sich. Genetische<br />
Themen wie die leibliche Habitualität oder passive Prozesse können aus der Ersten-Person-<br />
Perspektive nicht mehr vollständig reflexiv zugänglich gemacht werden. Sie erfordern insofern eine<br />
Bestätigung durch Dritte, d.h. eine Erweiterung um die Dritte-Person-Perspektive der empirischen<br />
Wissenschaften. Grenzbereiche der Phänomenologie lassen sich etwa in (neuro)psychologischen<br />
Experimenten anschaulich fassen. Trotz der methodischen und begrifflichen Unterschiede soll in<br />
Anbetracht aktueller dynamischer Konzepte wie der embodied cognition oder der neuronalen Plastizität<br />
<strong>für</strong> eine gemeinsame genetische Perspektive plädiert werden: Nur in der Überschneidung von<br />
subjektiven- und objektiven Untersuchungsmethoden kann man der biologischen, psychologischen<br />
und geschichtlichen Entwicklung des Subjekts in seiner Kontinuität auf die Spur kommen und die<br />
Interaktion desselben mit seiner Um- oder Lebenswelt adäquat beschreiben. ◆<br />
121<br />
W