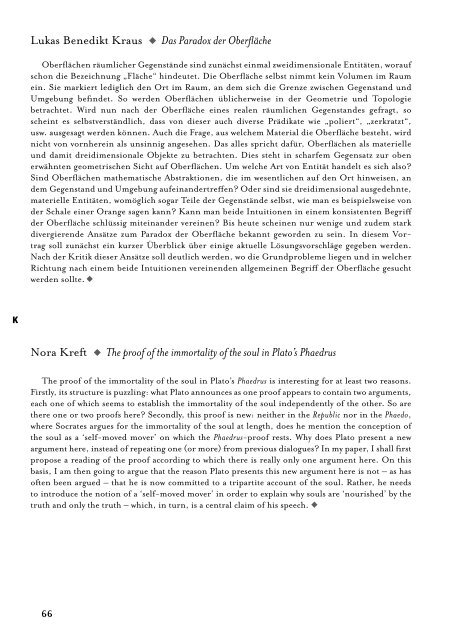Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
K<br />
Lukas Benedikt Kraus ◆ Das Paradox der Oberfläche<br />
Oberflächen räumlicher Gegenstände sind zunächst einmal zweidimensionale Entitäten, worauf<br />
schon die Bezeichnung „Fläche“ hindeutet. Die Oberfläche selbst nimmt kein Volumen im Raum<br />
ein. Sie markiert lediglich den Ort im Raum, an dem sich die Grenze zwischen Gegenstand und<br />
Umgebung befindet. So werden Oberflächen üblicherweise in der Geometrie und Topologie<br />
betrachtet. Wird nun nach der Oberfläche eines realen räumlichen Gegenstandes gefragt, so<br />
scheint es selbstverständlich, dass von dieser auch diverse Prädikate wie „poliert“, „zerkratzt“,<br />
usw. ausgesagt werden können. Auch die Frage, aus welchem Material die Oberfläche besteht, wird<br />
nicht von vornherein als unsinnig angesehen. Das alles spricht da<strong>für</strong>, Oberflächen als materielle<br />
und damit dreidimensionale Objekte zu betrachten. Dies steht in scharfem Gegensatz zur oben<br />
erwähnten geometrischen Sicht auf Oberflächen. Um welche Art von Entität handelt es sich also?<br />
Sind Oberflächen mathematische Abstraktionen, die im wesentlichen auf den Ort hinweisen, an<br />
dem Gegenstand und Umgebung aufeinandertreffen? Oder sind sie dreidimensional ausgedehnte,<br />
materielle Entitäten, womöglich sogar Teile der Gegenstände selbst, wie man es beispielsweise von<br />
der Schale einer Orange sagen kann? Kann man beide Intuitionen in einem konsistenten Begriff<br />
der Oberfläche schlüssig miteinander vereinen? Bis heute scheinen nur wenige und zudem stark<br />
divergierende Ansätze zum Paradox der Oberfläche bekannt geworden zu sein. In diesem Vortrag<br />
soll zunächst ein kurzer Überblick über einige aktuelle Lösungsvorschläge gegeben werden.<br />
Nach der Kritik dieser Ansätze soll deutlich werden, wo die Grundprobleme liegen und in welcher<br />
Richtung nach einem beide Intuitionen vereinenden allgemeinen Begriff der Oberfläche gesucht<br />
werden sollte. ◆<br />
Nora Kreft ◆ The proof of the immortality of the soul in Plato’s Phaedrus<br />
The proof of the immortality of the soul in Plato’s Phaedrus is interesting for at least two reasons.<br />
Firstly, its structure is puzzling: what Plato announces as one proof appears to contain two arguments,<br />
each one of which seems to establish the immortality of the soul independently of the other. So are<br />
there one or two proofs here? Secondly, this proof is new: neither in the Republic nor in the Phaedo,<br />
where Socrates argues for the immortality of the soul at length, does he mention the conception of<br />
the soul as a ‘self-moved mover’ on which the Phaedrus-proof rests. Why does Plato present a new<br />
argument here, instead of repeating one (or more) from previous dialogues? In my paper, I shall first<br />
propose a reading of the proof according to which there is really only one argument here. On this<br />
basis, I am then going to argue that the reason Plato presents this new argument here is not – as has<br />
often been argued – that he is now committed to a tripartite account of the soul. Rather, he needs<br />
to introduce the notion of a ‘self-moved mover’ in order to explain why souls are ‘nourished’ by the<br />
truth and only the truth – which, in turn, is a central claim of his speech. ◆<br />
66