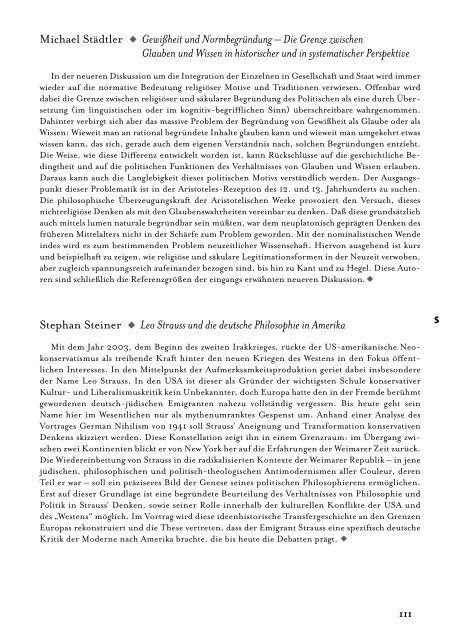Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Verlag.Buchhandel.Service. - Österreichische Gesellschaft für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Michael Städtler ◆ Gewißheit und Normbegründung – Die Grenze zwischen<br />
Glauben und Wissen in historischer und in systematischer Perspektive<br />
In der neueren Diskussion um die Integration der Einzelnen in <strong>Gesellschaft</strong> und Staat wird immer<br />
wieder auf die normative Bedeutung religiöser Motive und Traditionen verwiesen. Offenbar wird<br />
dabei die Grenze zwischen religiöser und säkularer Begründung des Politischen als eine durch Übersetzung<br />
(im linguistischen oder im kognitiv-begrifflichen Sinn) überschreitbare wahrgenommen.<br />
Dahinter verbirgt sich aber das massive Problem der Begründung von Gewißheit als Glaube oder als<br />
Wissen: Wieweit man an rational begründete Inhalte glauben kann und wieweit man umgekehrt etwas<br />
wissen kann, das sich, gerade auch dem eigenen Verständnis nach, solchen Begründungen entzieht.<br />
Die Weise, wie diese Differenz entwickelt worden ist, kann Rückschlüsse auf die geschichtliche Bedingtheit<br />
und auf die politischen Funktionen des Verhältnisses von Glauben und Wissen erlauben.<br />
Daraus kann auch die Langlebigkeit dieses politischen Motivs verständlich werden. Der Ausgangspunkt<br />
dieser Problematik ist in der Aristoteles-Rezeption des 12. und 13. Jahrhunderts zu suchen.<br />
Die philosophische Überzeugungskraft der Aristotelischen Werke provoziert den Versuch, dieses<br />
nichtreligiöse Denken als mit den Glaubenswahrheiten vereinbar zu denken. Daß diese grundsätzlich<br />
auch mittels lumen naturale begründbar sein müßten, war dem neuplatonisch geprägten Denken des<br />
früheren Mittelalters nicht in der Schärfe zum Problem geworden. Mit der nominalistischen Wende<br />
indes wird es zum bestimmenden Problem neuzeitlicher Wissenschaft. Hiervon ausgehend ist kurz<br />
und beispielhaft zu zeigen, wie religiöse und säkulare Legitimationsformen in der Neuzeit verwoben,<br />
aber zugleich spannungsreich aufeinander bezogen sind, bis hin zu Kant und zu Hegel. Diese Autoren<br />
sind schließlich die Referenzgrößen der eingangs erwähnten neueren Diskussion. ◆<br />
Stephan Steiner ◆ Leo Strauss und die deutsche Philosophie in Amerika<br />
Mit dem Jahr 2003, dem Beginn des zweiten Irakkrieges, rückte der US-amerikanische Neokonservatismus<br />
als treibende Kraft hinter den neuen Kriegen des Westens in den Fokus öffentlichen<br />
Interesses. In den Mittelpunkt der Aufmerksamkeitsproduktion geriet dabei insbesondere<br />
der Name Leo Strauss. In den USA ist dieser als Gründer der wichtigsten Schule konservativer<br />
Kultur- und Liberalismuskritik kein Unbekannter, doch Europa hatte den in der Fremde berühmt<br />
gewordenen deutsch-jüdischen Emigranten nahezu vollständig vergessen. Bis heute geht sein<br />
Name hier im Wesentlichen nur als mythenumranktes Gespenst um. Anhand einer Analyse des<br />
Vortrages German Nihilism von 1941 soll Strauss’ Aneignung und Transformation konservativen<br />
Denkens skizziert werden. Diese Konstellation zeigt ihn in einem Grenzraum: im Übergang zwischen<br />
zwei Kontinenten blickt er von New York her auf die Erfahrungen der Weimarer Zeit zurück.<br />
Die Wiedereinbettung von Strauss in die radikalisierten Kontexte der Weimarer Republik – in jene<br />
jüdischen, philosophischen und politisch-theologischen Antimodernismen aller Couleur, deren<br />
Teil er war – soll ein präziseres Bild der Genese seines politischen Philosophierens ermöglichen.<br />
Erst auf dieser Grundlage ist eine begründete Beurteilung des Verhältnisses von Philosophie und<br />
Politik in Strauss’ Denken, sowie seiner Rolle innerhalb der kulturellen Konflikte der USA und<br />
des „Westens“ möglich. Im Vortrag wird diese ideenhistorische Transfergeschichte an den Grenzen<br />
Europas rekonstruiert und die These vertreten, dass der Emigrant Strauss eine spezifisch deutsche<br />
Kritik der Moderne nach Amerika brachte, die bis heute die Debatten prägt. ◆<br />
111<br />
S